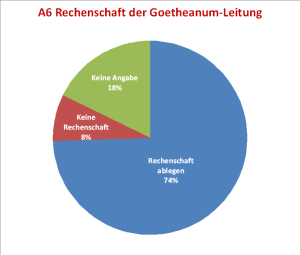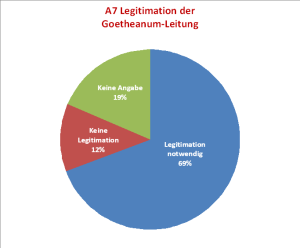von Thomas Heck | Apr 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Alternative Beschlussvorlage zu Anträgen 6.1 und 6.2:
Die Mitgliederversammlung 2024 der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft empfiehlt, bei zukünftigen Konstitutionsprozessen die Einführung eines Delegiertensystems sowie die Einführung konsultativer Abstimmungen in Mitgliederversammlungen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Mit diesem Votum wird in wesentlichen Teilen dem ursprünglichen Antrag Uwe Werners entsprochen, ohne jedoch dessen Ansichten, Argumentationen und Begründungen zu folgen.
Begründung
Es erscheint absolut berechtigt, Überlegungen anzustellen, wie Gesellschaftsbeschlüsse auf eine breitere Basis gestellt werden können. Insofern ist gegen ein Delegiertensystem oder weltweite Abstimmungen nicht grundsätzlich etwas einzuwenden, sofern die gesellschaftlichen und sozialen Voraussetzungen dafür gegeben sind, z.B. in ausreichender Berichterstattung und freier Kommunikation der Mitgliedschaft untereinander. Solange die notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann von der Mitgliederversammlung eine notwendige Zustimmung nicht erwartet werden.
Uwe Werner begründet seinen Antrag im Wesentlichen mit vermeintlichen Absichten Rudolf Steiners, was jedoch in Frage zu stellen ist:
Kann es wirklich sein, dass erst nach 100 entdeckt worden sei, dass Rudolf Steiner «eine urdemokratisch legitimierte jährliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) der Weltgesellschaft auf der Basis des Delegiertenprinzips»[1] (so Uwe Werner) im Sinn gehabt haben soll? Die von Uwe Werner angeführten Äusserungen[2] Rudolf Steiners standen nicht im Zusammenhang mit Beschlussfassungen und wurden lediglich an der Weihnachtstagung geäussert – vor den ca. 800 anwesenden Mitgliedern bzw. den Schweizer Delegierten. «Für Rudolf Steiner waren die jährlichen Mitgliederversammlungen als Delegiertenversammlungen eine Selbstverständlichkeit.», so die Ansicht Uwe Werners. Eine erstaunliche Annahme, denn über eine Angelegenheit dieser Tragweite hätte Rudolf Steiner gewiss auch die nicht an der Weihnachtstagung anwesenden ca. 11.000 Mitglieder informiert. Aber nichts in dieser Richtung findet sich in seinen Berichten, Briefen und sonstigen Ausführungen nach der Weihnachtstagung, absolut nichts. Was Uwe Werner nicht erwähnt: In Rudolf Steiners «Entwurf einer Geschäftsordnung» (Beiheft zu GA 260a, S. 4f.) heisst es: «4. In allen Versammlungen der Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach führt der Leiter der Anthroposophischen Gesellschaft den Vorsitz. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied der Gesellschaft eine Stimme. Bei Delegierten-Versammlungen wird das Stimmrecht durch den Vorsitzenden jeweils bei Beginn der Versammlung festgestellt.» Alle Versammlungen sind alle Versammlungen und in den Statuten ist keine Rede davon, dass die Jahresversammlungen als Delegierten-Versammlungen in diesem Sinne hätten stattfinden sollen. Dass es die Aufgabe der Delegierten gewesen wäre, in beide Richtungen zu berichten, ist keine Frage. Und so gibt es keinerlei Hinweise, dass in irgendeiner Weise Stimmrechte an Delegierte hätten übertragen werden sollen und einzelne Mitglieder kein Stimmrecht gehabt hätten oder nicht hätten haben sollen.
Bei den von Uwe Werner vorgebrachten Argumenten und Belegen für seine Thesen (die er auch selber lediglich als Thesen bezeichnet) handelt es sich weitgehend um Ansichten und Interpretationen, die zum Teil dazu führen, Rudolf Steiner – gewiss unbeabsichtigt – unüberlegtes und intransparentes Handeln zu unterstellen.
So sei die Weihnachtstagungs-Gesellschaft von Rudolf Steiner bewusst nicht als rechtfähiger Verein begründet worden – was absolut zutreffend ist.[3] Er habe dann aber am 29. Juni 1924 diese ins Handelsregister eintragen lassen wollen, wozu jedoch die Vereinsform Voraussetzung gewesen wäre. Und so unterstellt Uwe Werner Rudolf Steiner auch explizit unüberlegtes Vorgehen und bringt dies zum Ausdruck: «Dieser Rechtsvorgang war nicht gut vorbereitet worden und scheiterte dann vor allem deshalb, weil alles Vereinsmässige im Statut der Gesellschaft fehlte.»[4] Das soll Rudolf Steiner übersehen haben? Welch eine Aussage, sollte doch alles Vereinsmässige aus den Versammlungen herausgehalten werden – schon seit 1912!!! Sollten Uwe Werners Ansichten zum 29. Juni 1924 tatsächlich Rudolf Steiners Absichten entsprochen haben, wären die von ihm an diesem Tag formulierten Statuten für diesen Zweck allerdings vollkommen widersinnig und ungeeignet gewesen.
War Rudolf Steiner wirklich ein Dilettant in diesen Dingen? Kann man ernsthaft annehmen, dass er derartig unüberlegt und intransparent gehandelt hat und auch die Mitgliedschaft über seine tatsächlichen Absichten nicht genügend informierte? Macht es Sinn, wenn die Statuten der Weihnachtstagung Mitgliederanträge explizit erwähnen – eine Abstimmung aber Delegierten vorbehalten sein soll, ohne dass dies erwähnt wurde?
Auch wenn Uwe Werners Annahmen und Thesen sehr ausführlich und umfangreich sind, erscheinen diese jedoch selber in wesentlichen Aspekten unüberlegt, in ihren Konsequenzen nicht zu Ende gedacht und manche, seine Thesen stützenden Argumente, selektiv ausgewählt. Im Falle eines wissenschaftlichen Anspruchs in Bezug auf die vorgelegten Ausführungen wäre eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen anderer Konstitutionsforscher bzw. deren Widerlegung zwingend notwendig gewesen. So widersprechen Uwe Werners Ausführungen in wesentlichen Aspekten selbst der im Rahmen der AAG erarbeiteten Chronologie[5], die er selbst mitunterzeichnet hat (allerdings ohne daran aktiv mitgearbeitet zu haben!). Wäre nicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zu erwarten, dass von dieser Chronologie abweichende Ansichten entsprechend begründet werden? Wobei dies sicher nicht nur von Uwe Werner zu erwarten wäre!
Rudolf Steiner im siebten Mitgliederbrief: «Was der eine behauptet, muss Bedeutung für den andern haben; was der eine erarbeitet, muss für den andern einen gewissen Wert haben.»
In diesem Sinne erscheint es notwendig zum Ausdruck zu bringen, dass mit dem Votum zu diesem Antrag die Mitgliederversammlung sich die Ansichten, Argumentationen und Begründungen Uwe Werners nicht zu eigen machen, sondern die Empfehlungen unabhängig davon ausspricht.
Thomas Heck, 14. April 2024, thomas.heck@posteo.ch
[1] Alle Zitate Uwe Werners ohne weiteren Einzelnachweis finden sich in seinem Thesenpapier https://konstitution.anthroposophie.online/uw.pdf sowie seinem Aufsatz «Ein geeigneter Binnenraum für die Pflege der Geisteswissenschaft. Das Freiheitsideal im Werden der anthroposophischen Gesellschaft» im Archivmagazin 10. Dez. 2020, S. 125 – 162.
[2] GA 260/1985, S. 122 und 157.
[3] Ausnahmslos alle diejenigen, die behaupten, es sei ein rechtsfähiger Verein an der Weihnachtstagung gegründet worden, sind den Nachweis dafür bis heute schuldig geblieben bzw. setzen sich über mehrere vorliegende juristische Aussagen und Einschätzungen hinweg. www.wtg-99.com/Rundbrief_69
[4] Artikel von Uwe Werner im Archivmagazin, auf den er sich explizit bezieht.
[5] Im Login-Bereich auf www.goetheanum.org oder https://konstitution.anthroposophie.online/
von Thomas Heck | Apr 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Obwohl die diesjährige Mitgliederversammlung aufgrund der zu verhandelnden und abzustimmenden Themen durchaus bedeutsam für die Zukunftsfähigkeit und Wirksamkeit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sein wird, besteht im Moment der Eindruck, das nur mit einer geringen Teilnahme gerechnet werden kann. Für uns zeigt sich dies vor allem an dem unerwartet geringen Interesse an den angebotenen Vorbereitungsmöglichkeiten (an die hier erinnert werden soll). Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die sich bereits in dem rückläufigen Interesse an den Mitgliederforen gezeigt hat – sowohl vor Ort, vor allem aber online.
Ist die Resignation über die problematischen Verhältnisse in unserer Gesellschaft bereits so weit fortgeschritten, dass kaum noch Hoffnung auf Veränderung besteht? Es gibt gewiss berechtigte Gründe für eine derartige Haltung – und dies zeigt sich ja auch in der hohen Zahl der Austritte[1] (dabei handelt sich keineswegs nur um Vermutungen, die Ergebnisse unserer Umfragen sprechen eine eindeutige Sprache).
Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass in jeder Art von Gemeinwesen die bestehenden Verhältnisse davon abhängig sind, inwieweit sie von denen getragen oder geduldet werden, die das Gemeinwesen bilden. Denn letztlich liegt die eigentliche Verantwortung für die Verhältnisse bei der Zivilbevölkerung, in unserem Gemeinwesen «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» bei der Mitgliedschaft! Die wesentlichen Zukunftsentscheidungen können nur von denjenigen getroffen werden, die sich einbringen und an den entsprechenden Versammlungen teilnehmen. Wer sich nicht beteiligt – sei es durch Enthaltung oder Nicht-Teilnahme – stützt letztlich die bestehenden Verhältnisse, auch wenn dies nicht gewollt ist.
So wäre eine breite Beteiligung an der Mitgliederversammlung wünschenswert, damit die zu treffenden Entscheidungen eine genügend grosse Grundlage haben – ganz gleich, was bzw. wie entschieden wird.
Der Einwand, es sei doch nur eine kleine Minderheit, die die Entscheidungen für die ganze Gesellschaft trifft, entkräftet sich inzwischen selber, denn die Weltgesellschaft hat heute die Möglichkeit, bequem vom Wohnzimmer aus teilzunehmen und kann auch mitabstimmen. Müssten nicht von den 42.000 Mitgliedern eher tausende als hunderte online teilnehmen? Das war sicher erwartet worden, stattdessen waren es zwischen 150 und 300, die das Geschehen live angeschaut haben.
Dass online nur fakultativ abgestimmt werden (aus rechtlichen Gründen), mag man beklagen. Aber wer beklagt es denn? Es klagt vor allem die Minderheit derer, die die Gesellschaft leiten bzw. diesen nahestehen! Es sind eben nicht die über 40.000 Mitglieder, die nicht teilnehmen, von diesen ist nichts zu sehen und zu hören – und vermutlich werden diese nicht einmal mehr von der Leitung erreicht.
Man stelle sich doch einmal vor, dass z.B. 2.000 Online-Teilnehmer an einer Mitgliederversammlung gänzlich anders abstimmen würden als z.B. 400 Teilnehmer im Saal. Damit würde reales Leben in der Gesellschaft sichtbar, das könnte und sollte zu regem weltweitem Austausch führen und würde in jedem Fall deutliche Wirkungen erzeugen. Ich persönlich glaube nicht, dass dann das Minderheitenvotum, welches rechtlich gültig wäre, einfach durchgesetzt würde. Ich persönlich würde das Eintreten einer solchen Situation auf jeden Fall positiv werten und es wären dann Wege zu suchen, wie damit angemessen umgegangen werden könnte.
Allerdings sieht es im Moment nicht danach aus, dass dies eintreten kann. Und so haben wir eben die Situation, dass trotz bestehender Möglichkeiten sich nicht mehr Mitglieder für die Gesellschaftsangelegenheiten interessieren und engagieren. Das ist einfach eine Tatsache, die hinzunehmen ist.
Peter Selg stellte 2018 (nach der Nichtbestätigung von Paul Mackay und Bodo von Plato) fest:
«Die Mitglieder sind urteilsfähig, zumindest diejenigen, die die Entwicklung des Goetheanum und der Vorstandsarbeit intensiv verfolgen; man braucht auf die Menschen nicht einzureden und sie von diesem oder jenem zu überzeugen versuchen. Man sollte vielmehr «in Ruhe abwarten, was die Mitglieder selber wollen» (Ita Wegman), nachdem man sie hinreichend informiert hat.»
Insofern ist es vollkommen legitim, dass diejenigen, die an der Mitgliederversammlung teilnehmen, auch diejenigen sind, die über die zur Abstimmung stehenden Fragestellungen entscheiden.
Thomas Heck, 16. April 2024
[1] https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_63.pdf#page=4
von Gastbeitrag | Apr 11, 2024 | Allgemein, Zeitgeschehen
Eine von der UNO geplante Vertragsänderung könnte die Meinungsfreiheit einschränken und die LGBT-Ideologie forcieren.
Die Vereinten Nationen stehen kurz davor, über eine Vertragsänderung des Römer Statuts abzustimmen. Der geplante Beschluss, der am 5. April fallen könnte, hätte potenziell weitreichende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Grundrechte vieler Menschen weltweit.
Der Kern dieses Vorschlags liegt darin, die biologische Definition von Geschlecht aus dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu streichen und Aussagen über dieses Thema sowie über Leben, Familie und Sexualität zu kriminalisieren. Selbst das einfache Zitieren von Bibelstellen, die die traditionelle Sichtweise auf Geschlecht und Familie unterstützen, könnte als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen werden.
Dieser Vorschlag wird von radikalen Globalisten und Lobbyorganisationen vorangetrieben, die darauf drängen, jeglichen Widerstand gegen die LGBT-Ideologie zu unterdrücken.
Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, könnten Personen, die an traditionellen Überzeugungen festhalten, schwerwiegende Einschränkungen der Meinungsfreiheit gewärtigen.
Weiterlesen auf Transition-News
Quelle: Transition-News: https://transition-news.org/uno-abstimmung-traditionelle-ansichten-uber-geschlecht-konnten-kriminalisiert
von Thomas Heck | Apr 10, 2024 | Allgemein, Zeitgeschehen
Beiträge und Videos von Dr. Alexander Korte zum Thema Transidentität und Transsexualität
Zusammenfassung: Das Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum Geburtsgeschlecht ist nicht neu, als Phänomen kann es bis in die antike Mythologie zurückverfolgt werden. Aber es war stets selten, wohingegen aktuell ein sprunghafter Anstieg von Abweichungen im Geschlechtsidentitätserleben bei Jugendlichen zu verzeichnen ist. Der Text geht dieser Problematik anhand der Frage nach, inwieweit diese Entwicklung auch ein Resultat kultureller und vor allem aber medientechnologischer Umbrüche ist, die bedingen, dass Jugendliche sich im „falschen Geschlecht“ wähnen und im Extremfall eine Transition anstreben. Die wichtigsten Eckpunkte des geplanten deutschen „Selbstbestimmungsgesetzes“ werden vorgestellt, das allerdings der zugrundeliegenden Problematik kaum gerecht werden dürfte. Der Text schließt damit, dass er diesbezüglich eine Reihe offener Fragen benennt, erste Antworten versucht und die Vorteile eines explorativen, genderkritischen gegenüber einem transaffirmativen Therapieansatz zusammenfasst.
Weiterlesen auf der Internetseite Als PDF herunterladen
von Thomas Heck | Apr 8, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Gesellschaft
Wie bereits im letzten Jahr sind schon allein die Anzahl der Anträge sowie die zu verhandelnden Themen an der Mitgliederversammlung Ausdruck des Bedürfnisses aus der Mitgliedschaft nach Veränderungen im Verhältnis Mitgliedschaft und Leitung der Gesellschaft. Hinzu kommt die Bereitschaft, Mitverantwortung für die Gesellschaftsangelegenheiten zu übernehmen. Dem entgegen steht ein offensichtliches Bestreben, die seit Rudolf Steiners Tod entstandene einheitsstaatsähnliche Leitungsstruktur zu erhalten.
So kann der Eindruck entstehen, dass die an der diesjährigen Mitgliederversammlung zu treffenden Entscheidungen für das weitere Schicksal der Gesellschaft von grosser Bedeutung sein werden: Wird ein verbindlicher Prozess zu Erneuerung der Sozialstrukturen beginnen können oder werden sich die restaurativen Tendenzen durchsetzen?
Zur Vorbereitung der Generalversammlung (ich verwende den üblichen Begriff, besser aber wäre: Mitgliederversammlung) wird es demnächst mehrere Aussendungen geben. Ausserdem sollen Vorbereitungstreffen stattfinden – online und vor Ort in Dornach. Folgende Termine sind vorgesehen:
Online:
Freitag, 12. April und Donnerstag 18. April 2024, jeweils 20 – 21:30 Uhr
Dornach
Donnerstag, 25. April 2024, 19.30 – 21.30 Uhr. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.
Anmeldung zu allen Terminen ist notwendig!
von Gastbeitrag | Apr 2, 2024 | Allgemein, Nicht Anthroposophisch, WHO, Zeitgeschehen
Verhandlungen über Pandemievertrag stocken
Verhandlungsstand kurzzeitig öffentlich geworden
Gesundheitspolitiker kritisieren WHO und Bundesregierung
2. April 2024 Quelle: (multipolar)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerät wegen geplanter Vertragsinhalte und Transparenzproblemen bei neuen Pandemie- und Gesundheitsvorschriften unter wachsenden öffentlichen Druck. Bei der aktuellen Verhandlungsrunde zum Pandemievertrag, die vergangenen Donnerstag (28. März) am WHO-Sitz in Genf zu Ende ging, erzielten die teilnehmenden Unterhändler verschiedener Staaten keine Einigung. Die Positionen westlicher Länder und vieler Staaten des globalen Südens liegen noch weit auseinander. Ziel ist es, auf der Weltgesundheitsversammlung der 194 Mitgliedsstaaten der WHO Ende Mai sowohl den geplanten neuen Pandemievertrag als auch die Neufassung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu verabschieden. Letztgenannte werden Ende April weiter verhandelt.
Der US-amerikanische Publizist James Roguski hat in einem Beitrag die seiner Ansicht nach wichtigsten Punkte der Änderungen zusammengefasst. Der Journalist Norbert Häring hat sie auf seinem Blog übersetzt. Demnach bekommt der Generaldirektor der WHO mit den IGV künftig die Möglichkeit, drei verschiedene Stufen von internationalen Gesundheitsnotlagen auszurufen. Die Organisation soll Standards für digitale und analoge Impf- und Testausweise entwickeln und bestimmen, welche Impfstoffe oder Medikamente für den Pandemiefall zugelassen werden. Die WHO soll weiterhin eine „Pathogen-Tauschbörse“ von krank machenden Stoffen etablieren und allgemein verfügbar machen. Schließlich sollen Regierungen „Fehl- und Desinformationen“ bekämpfen und auch nichtstaatliche Akteure verpflichten, sich an die Vorschriften des IGV zu halten.
Andrej Hunko, Gesundheitspolitiker des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), kritisiert gegenüber Multipolar die Intransparenz der Änderungen, von deren Dimension den meisten Abgeordneten keine Vorstellung hätten. „Die Kompetenzerweiterungen der WHO insgesamt, aber auch des Generalsekretärs innerhalb der WHO sind insbesondere vor dem Hintergrund der unaufgearbeiteten Rolle der WHO während der Corona-Zeit nicht zustimmungsfähig“, sagt Hunko. Er werde selbst Ende Mai zu den WHO-Verhandlungen nach Genf fahren.
Auch Christina Baum von der AfD kritisiert die Pläne. „Die Änderungsvorschläge zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften lassen gefährliche Demokratieverluste durch die Machtkonzentration in den Händen nicht demokratisch legitimierter Organe erkennen.“ Sie weist darauf hin, dass die IGV nicht mehr nur empfehlenden Charakter haben sollten, sondern künftig unmittelbar bindendes Recht setzen können. Das Bundesgesundheitsministerium verweist derweil als Antwort auf eine Anfrage von Multipolar darauf, dass die Änderungen Ende November 2022 den Mitgliedstaaten öffentlich gemacht worden seien. Die Positionen der Bundesregierung würden eng mit den anderen EU-Mitgliedstaaten abgestimmt.
Dies ist einer der vielen Kritikpunkte der Juristin und ehemaligen WHO-Beraterin Silvia Behrendt. Im Interview mit Multipolar wies sie in der vergangenen Woche darauf hin, dass die Gesundheitspolitik Aufgabe der Mitgliedsstaaten der EU sei. Die Verhandlungen zu den Änderungen der IGV seien intransparent, „weil man noch tief im Verhandlungsprozess steckt. Es würde ja sonst sofort zerpflückt werden.“ Nach den Regularien der IGV müssen die Änderungsvorschläge den Mitgliedsstaaten mindestens vier Monate vor der Abstimmung vorliegen. „Die Öffentlichkeit sollte die Sinnhaftigkeit der neuen Befugnisse der WHO angesichts der Hastigkeit und der falschen Begründungen für die Missachtung der rechtmäßigen Prozesse hinterfragen“, so Behrendt.
Die Internationalen Gesundheitsvorschriften wurden erstmals 1969 unterzeichnet und 2005 neu gefasst. Sie sind völkerrechtlich bindende Vorschriften, der Weltgesundheitsorganisation, die grenzüberschreitende Gesundheitsrisiken eindämmen sollen. Die geplanten Änderungen müssen auf der Weltgesundheitsversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden und treten dann nach bestimmten Fristen in Kraft. Einige Punkten müssen nach der Verabschiedung möglicherweise noch in nationales Recht übertragen werden, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Der Pandemievertrag ist neu, benötigt eine Zweidrittelmehrheit und jeweils eine Ratifizierung in den Mitgliedsstaaten der WHO, um in Kraft zu treten.
Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung von der Seite des Multipolar-Magazins übernommen: https://multipolar-magazin.de/meldungen/0034
von Thomas Heck | Apr 2, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
„Kaspar Hauser und der Begriff der Menschwerdung“
Als Kaspar Hauser wie aus dem Nichts zu Pfingsten 1828 in der Welt erschien, wurde er einerseits bezeichnet als ein halbwilder Tiermensch, andererseits als ein engelgleiches Wesen aus längst vergangenen Äonen. In kürzester Zeit vermochte er dann eine rasante Entwicklung zu durchlaufen und Teil der „zivilisierten“ Gesellschaft zu werden, wobei er jedoch auch Entscheidendes verlor. Und so ist es nur verständlich, dass Jakob Wassermann bezüglich seines berühmten Kaspar-Hauser-Romans aus dem Jahre 1908 sagt, dieser sei „die Darstellung einer Menschwerdung.“ Der Begriff der „Menschwerdung“ aber ist in unserer heutigen Zeit inzwischen zu einer großen Frage geworden, da der Mensch sich ja nun anschickt, anhand technischer Hilfsmittel überwinden zu wollen! Dem „Transhumanismus“ soll die weitere Entwicklung anvertraut werden! Diese geschähe dann aber vorrangig nur noch von „Außen“, nicht mehr von „Innen“ her, und genau dies wäre das Fatale, denn dieser „Fortschritt“ gliche letzten Endes dann eher nur noch einer Leihgabe als einer tatsächlichen Aneignung! Nach den offiziellen Begrüßungsworten durch Vertreter der Stadt Ansbach wird Eckart Böhmer sich dieser Fragen annehmen, für die Kaspar Hauser zeichenhaft steht. Die Eröffnung der Festspiele wird musikalisch umrahmt durch das DUO CHAGALL, das die beiden innigen Werke „Spiegel im Spiegel“ und „Vater Unser“ von Arvo Pärt darbieten wird!
ECKART BÖHMER, Intendant, Theaterregisseur, Referent und Autor rief 1998 gemeinsam mit der Stadt Ansbach die alle zwei Jahre stattfindenden Kaspar-Hauser-Festspiele ins Leben. 2018 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Ansbach verliehen.
Weitere Informationen, Programm, Anmeldung:
Stadt Ansbach
Programm
von Thomas Heck | Mrz 29, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, English
Tasks and responsibilities in the current world situation
The significance of 8 February
With the renaming of the Building Society (Bauverein) as the General Anthroposophical Society on 8 February 1925 and its entry in the commercial register, the “unified constitution” sought by Rudolf Steiner and at the same time a threefold social structure – consisting of the School of Spiritual Science, the member society of the Christmas Conference “Anthroposophical Society” and the administrative and external representative body “General Anthroposophical Society” – had been achieved. (See chronology[1] , a result of the work of the two-year colloquia).
However, it is quite obvious that nobody understood this at the time and to this day the most diverse opinions are held on this subject. Moreover, an astonishing “wave of confusion” immediately set in in connection with the events surrounding 8 February, which has “successfully” prevented a clarification and agreement of views to this day. (Newsletter 74)[2] How is this possible? An identity-forming clarity and a corresponding awareness in the membership would strengthen the General Anthroposophical Society enormously, while living in the most diverse images and ideas or even in ignorance or confusion must have a correspondingly weakening effect in a Society whose members should lead humanity on the path of the development of the Consciousness Soul. The work of the opposing spiritual powers, “who make use of people on Earth”, is also evident in the fact that for more than six decades, the so-called constitutional question has repeatedly sparked serious conflicts, which have had a traumatising effect on several occasions, so that these questions could not be discussed for years afterwards. (This made the second constitutional conference, which took place in November 2023 and was characterised by an atmosphere of goodwill and mutual appreciation – despite all the remaining differences of opinion – all the more pleasing).
Why is this topic so controversial? We know from Rudolf Steiner that behind all external events there is in reality a “struggle against the spirit”. The effectiveness of anthroposophy as a force for cultural renewal also depends on whether it maintains the social corporeality appropriate to it. To make this possible, Rudolf Steiner made his last attempt to save it with the Christmas Conference. The clarification of the constitutional question, Rudolf Steiner’s intentions and the actual form of the General Anthroposophical Society would however, inevitably lead to the realisation that we have a mixture of Christmas Conference Society and Building Society elements in our Society and structures similar to a unitary state, i.e. a hybrid being with centralism. It would be plausible if interests were at work here that wanted to prevent such a realisation, because who benefits from these forms? Could they be the forms that anthroposophy needs to cultivate and develop? This will be discussed again later.
Current developments
Over the past two years, initiatives and a commitment to shared responsibility have increasingly emerged from the membership. Through the members’ forums and constitutional conferences[3] , discussions and social processes have also begun since the 2023 General Assembly, giving rise to the hope that we can now find ways for further beneficial forms of cooperation and a contemporary reorganisation of the Society. It seems possible that now – 99 years after the last weeks of Rudolf Steiner’s life on earth and the memorable 8 February – there is sufficient goodwill for the necessary changes to lead the General Anthroposophical Society out of its state of obsolete, unitary state-like structures. However, as a next step, it would also be necessary and desirable to unite the processes of the members’ forums with those of the upcoming 3rd constitutional conference entitled “What could become?”
The consequences of incomprehension and incompleteness
It is part of Rudolf Steiner’s life and sacrifice that an infinite number of his impulses were not sufficiently received and understood by people.[4] The successful work of the opposing forces went so far that he was met by the greatest “inner opposition” through the membership and the Society itself became the greatest obstacle to anthroposophy and Rudolf Steiner’s work. Therefore, it is also part of this fateful signature of the obstacles to the unfolding of anthroposophy on Earth that – despite all the goodwill that can certainly be assumed in people, as far as the conscious will is concerned – mistakes have been made out of a lack of understanding – with serious consequences.
One of these errors, which only recently came to light, concerns the Foundation Stone for the first Goetheanum. (“The interpenetrating Foundation Stone“[5] ). If you let the pictures sink in, you may get the impression that one of them remains floating above the Earth. The other one lies on it and rests on it, it can arrive on Earth. – And so this gesture is reflected in the tragic fate of the building: it could never be handed over to its true purpose, it was never inaugurated – only “opened”. And this with a conference whose abstract contributions of conventional natural science, according to Rudolf Steiner, stood in stark, sharp contrast to the essence of the building and its living design.
In the last weeks of his life 99 years ago, Rudolf Steiner still hoped almost every day that he would be able to resume work on the interior model for the second building. So much depended on him being able to complete it! In a letter to Marie Steiner dated 5 March 1925, he wrote: “… My condition is only improving slowly. And I must soon be fit for work, because after everything that has happened, it is impossible to imagine what it would be like if my illness were to interrupt the construction work.”[6] The question may arise here – why did so much depend on him being able to complete the model of the interior construction? The same applies to the Representative of Humanity, which he was so keen to continue working on. Why – since it already seemed almost finished?
If one looks at the Representative of Humanity with this question in mind and the area that remained unfinished, a shocking answer may emerge. Raw wood, completely unworked and untransformed, remained in place precisely where the effect of the Christ being should have penetrated down from the heart through the arm and hand into Ahriman’s realm. The stream of light, love and life cannot penetrate into the cave to Ahriman, who would be tied up through the effect of Christ.
This tragedy is a prime example of Rudolf Steiner’s unfinished mission and the catastrophic consequences of this in the 20th century and right up to the present day: as if a gap had been left open for Ahriman and so much of the abundance of supersensible revelations was not allowed to arrive on Earth, could not arrive in human hearts. The Foundation Stone remained in limbo, the building was never consecrated, it was lost due to a lack of spiritual alertness and protection, the second Goetheanum could not be realised as a true “Michael-castle”, and a “gap” remained open for Ahriman right into the figure of the Representative of Humanity. – Due to the failure of human beings (which is meant without reproach, as it applies equally to us), Rudolf Steiner was unable to complete his mission and the work of Christ could not fully penetrate the earthly conditions. We know the consequences for human development and experience them to this day.
Unitary state and Ahriman
The fate of Rudolf Steiner’s impulses continues – as described – in the so-called constitutional question, in that Ahriman has been able to successfully obscure and confuse for almost a hundred years what Rudolf Steiner wanted to realise as the social form of the Society and – according to the results of two years of colloquium work – also achieved with the 8 February.
However, even if it has not yet been possible to reach a consensus on this issue among all the people researching it, there is still the possibility that the processes of the members’ forums and the constitutional conferences that began last year will lead to further fruitful social processes and contemporary organisations. – However, these two processes would have to be combined and a sufficient number of members and leaders would have to participate! Then something could emerge with a healing effect for the Society.
Only when this process is successful and we leave the centralised forms behind will the Society be able to fulfil some of its tasks in the current world situation. It would then represent something – no matter how small in its external impact – exemplary in terms of free social organisation in the world and be able to counterbalance the coming world dictatorship of Ahriman, which has already begun.
At this point, it is worth recalling Rudolf Steiner’s serious words, which have already been quoted several times and which make it clear what is at stake:
“A unitary state, regardless of whether it calls itself a monarchy, republic or democracy – as long as it is a unitary state (and not threefold) – serves the incarnation of Ahriman.“[7]
“But there are two things in the world today, and anyone who looks at the world honestly and sincerely, who is under no illusions, will see that there are two options: either Bolshevism over the whole world or threefolding! You may not like the threefold order; in that case, you have just decided in favour of an old world order!”[8]
“Bolshevism” in the sense of that time and the word itself no longer exists today, but the corresponding endeavours to enslave humanity certainly do.
Sorath works through Bolshevism.[9]
If we do not take the reality of spiritual beings working through and within the social forms seriously, the General Anthroposophical Society will not only become more and more “Ahrimanically perforated”, but will fall completely under his power.
It should be emphasised once again that these statements are not directed against individual people who have certainly taken up and accepted their leading tasks for anthroposophy with all their strength and good will. Yet we must no longer dream and remain asleep in the face of what Rudolf Steiner himself gave us in countless warnings and indications for the present! The attitude “everyone wants what is good” shows how precisely those spiritual beings – who are working through us unasked and unnoticed – are forgotten. Ahrimanic beings are actively working in obsolete centralised forms. Anyone who is familiar with the mystery dramas knows how cunning and powerful they are and how difficult it is, especially for the people involved, to recognise them. First and foremost, those who are not in leading positions are able to help. All members of the Society who live together in these structures are affected. The more a common awareness of this could arise, the stronger the liberating effect would become.
Understanding and love
One of the effects of the opposing powers through those people who are connected to anthroposophy is the predominantly too weak interest in the question: Who is Rudolf Steiner? If a sufficient number of members had lived with this as a deep inner question of the heart, he would not have left the earthly plane prematurely and might still have been able to fulfil his mission.
Rudolf Steiner’s life was in the hands of the members, it depended on their understanding (willingness) – and on their love. It was not the abundance of lectures that exhausted him, on the contrary – they “keep me healthy… What makes you tired are the dead thoughts that come to you; it is the lack of understanding, the non-understanding of the people that paralyses you.[10] And in a shocking way it becomes clear what was lacking above all in the membership: interest in Rudolf Steiner’s true nature.
Wilhelm Rath’s experience of the evening lectures during the Christmas Conference awakened in him a question and a hunch about Rudolf Steiner’s nature and he wrote a short essay on Thomas Aquinas, which he had it delivered to Rudolf Steiner, who was already lying on his sickbed. Rudolf Steiner’s heartfelt words of thanks have been passed down to us, with the remark “If more such things were written, I would not need to be ill”.[11]
Anna Samweber recalls how the question suddenly arose in her mind during a lecture – Who are you? – Who is Rudolf Steiner? – She would have liked to ask him immediately afterwards, but then did not want to bother him as he was always besieged by so many people. But Rudolf Steiner himself came up to her later and said “…you wanted to ask me something…?” And she asked the question. But he did not answer directly, instead encouraging her to research: She would find the answer in this life if she pondered who he was with love and enthusiasm.
When Sergei O. Prokofieff joined the Executive Board in 2001, he brought with him five heartfelt concerns and projects that he wanted to work towards. The first was: “Cultivating the relationship with Rudolf Steiner“[12] . – Towards the end of his life, he confessed that none of his five topics had met with a favourable response from his fellow Board members.
What would it mean today if this question were to live as a matter of the heart in a larger number of members? What effects would it have?
*
For those who want to explore the question of Rudolf Steiner’s nature, Sergei O. Prokofieff’s two works published after his death may be fundamental: “Rudolf Steiner and the Masters of Esoteric Christianity” and “Rudolf Steiner – Fragments of a Spiritual Biography”.
Eva Lohmann-Heck
*
Note: The statements quoted from Rudolf Steiner are not all identified as quotations or sources if they have already appeared in earlier newsletters, but reference is made above all to Nos. 58, 62 and 74, as well as the brochure “Tasks, aims and contemporary social structures of an anthroposophical society“[13] .
I ask for your understanding.
[1] https://www.konstitution.anthroposophie.online/Konstitution.pdf, see page 14.
[2] https://wtg-99.com/Rundbrief_74
[3] Next date 23 – 25 Feb 2024, https://goetheanum.ch/de/veranstaltungen/sow-die-konstitution-der.
[4] Gerhardt von Beckerath, “The path of suffering of Rudolf Steiner”, Dornach
[5] Michael Toepell, “Der sich durchdringende Grundstein”, in “Anthroposophie” 12/2023, AGiD Newsletter. Sent out with this newsletter or downloadable from the newsletter archive. www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv
[6] GA 262, p. 266, emphasis by Rudolf Steiner.
[7] GA 191, P. 213.
[8] GA 196, P. 133.
[9] GA 346, p. 122f.
[10] “Ita Wegman – Memories of Rudolf Steiner”, ed. Peter Selg, p. 41.
[11] Wilhelm Rath “Rudolf Steiner and Thomas Aquinas”, Perseus Verlag.
[12] Brochure “The Books of Sergei O. Prokofieff”, privately printed.
[13] https://wtg-99.com/Neue-Sozialstrukturen and at www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv.
von Thomas Heck | Mrz 26, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung
«Eines derjenigen Gebiete, wo Anthroposophie besonders fruchtbar werden kann, ist das medizinische. Ganz gewiß wird Anthroposophie für das Medizinische, namentlich für die Therapeutik unfruchtbar bleiben, wenn die Tendenz besteht, innerhalb des medizinischen Betriebes in der anthroposophischen Bewegung die Anthroposophie als solche in den Hintergrund zu drängen und etwa den medizinischen Teil unserer Sache so zu vertreten, daß wir denen gefallen, die vom heutigen Gesichtspunkte aus Medizin vertreten.» (GA 260, S. 47).
«Wenn wir dasjenige, was auf unserem Boden medizinisch erwächst, so beschreiben, daß wir den Ehrgeiz haben: Unsere Abhandlungen können bestehen vor den gegenwärtigen klinischen Anforderungen – dann, dann werden wir niemals mit den Dingen, die wir eigentlich als Aufgabe haben, zu einem bestimmten Ziele kommen. … Wir müssen den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden. Erst wenn wir den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden, es innerlich verabscheuen, dann wird Anthroposophie ihren Weg durch die Welt finden. Und in dieser Beziehung wird schon gerade das Wahrheitsstreben dasjenige sein, was in der Zukunft von Dornach hier ohne Fanatismus, sondern in ehrlicher, gerader Wahrheitsliebe verfochten werden soll.» (GA 260, S. 278f.)
Heute möchte man Mitgestalter sein
Matthias Girke brachte in dem Interview[1] mehrfach zum Ausdruck, dass man Mitgestalter sein wolle und rechtfertigte damit die Kooperationen mit der WHO und «One Health». Eine solche Kooperation aber ist nur möglich, wenn man die Sprache der Anthroposophie und der Anthroposophischen Medizin entsprechend anpasst, damit man die «open minded doctors» (Matthias Girke) auch erreicht (oder besser: nicht abschreckt?), sich deren Sprache anpasst (z.B. die Wesensglieder-Bezeichnungen) und von einer Mysterien-Medizin erst gar nicht spricht. Es ist offensichtlich: Um diese Kooperationen eingehen zu können, muss man sich in dem politisch und medial vorgegeben Wissenschaftsrahmen bewegen, darf diesen nicht in Frage stellen, um nicht als unwissenschaftlich diskreditiert zu werden. Konkret:
- Keine Infragestellung der Viren-Theorie, denn dies gilt als unwissenschaftlich bzw. verschwörungstheoretisch.
- Impfungen sind nicht infrage zu stellen, im Gegenteil, sie sind grundsätzlich sinnvoll und schützen. Insofern war eine eindeutig positive Haltung zu den genbasierten «Impfungen» zu kommunizieren.
- Volle Anerkennung der Schulmedizin – Anthroposophische Medizin ist (nur) eine Erweiterung derselben.
- Verschweigen derjenigen Aussagen Rudolf Steiners, die diesen Dogmen widersprechen.
- Bewusst falsche Darstellung im Zusammenhang mit Rudolf Steiners Pockenimpfung und seinen Aussagen dazu – wodurch er quasi als Impfbefürworter instrumentalisiert wurde.
So hat man sich angepasst, «kompatibel» gemacht mit diesen selbst aus naturwissenschaftlicher Sicht (!) fragwürdigen Dogmen. Zentrale anthroposophische Aspekte der Medizin werden zurückgestellt und die Anthroposophische Medizin der Schulmedizin angepasst, damit man vor den gegenwärtigen klinischen Anforderungen bestehen kann! – um anerkannt zu werden – in der Hoffnung, zukünftig anthroposophische Aspekte einbringen zu können?
Genau davor hatte Rudolf Steiner gewarnt!
Thomas Heck
[1] In «Ein Nachrichtenblatt», Ausgaben 11,13 und 14/2023.
von Thomas Heck | Mrz 15, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Die Entstehung der Goetheanum-Leitung / Reaktion des Vorstandes
In einer Reaktion des Vorstandes wurde erklärt, dass man den «Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung» nicht für abstimmungsfähig halte. Das ist nicht nachvollziehbar, handelt es sich doch um einen Antrag zur Änderung der Statuten und nach §8 liegt dies explizit im Aufgabenbereich der Generalversammlung. Insofern ist davon auszugehen, dass dieser Antrag Bestandteil der Tagesordnung der Generalversammlung sein wird. Es gibt aber auch ein Signal, vorher noch einmal ins Gespräch zu kommen, was u. U. zu Änderungen führen kann oder andere Lösungen ermöglichen könnte. Mit Blick auf die Aufgaben und die Entstehung der Goetheanum-Leitung sollen in dieser Ausgabe weitere Grundlagen dargestellt werden, die der eigenen Urteilsbildung dienen können. Dazu gehört auch, wie und unter welchen Begleitumständen die Goetheanum-Leitung entstanden ist sowie ein Blick auf die Rechtsform der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, innerhalb derer sich die Gesellschaft[1], das Goetheanum und die Hochschule gemeinsam befinden! Und der Souverän dieses «demokratischen Gemeinwesens» (Peter Selg 2018 in AWW 6/18) ist die Mitgliedschaft – vertreten durch die Mitgliederversammlung. Und wie in jedem Gemeinwesen kann und soll es innerhalb dieses Rechtskörpers Freiräume geben, in denen sich freies Geistesleben entfalten kann. Idealerweise ist in jeglichem freiheitlich orientierten Staatswesen z.B. der Lehrstuhlinhaber an einer Universität in Lehre und Forschung frei von staatlichen oder sonstigen Vorgaben zu halten. Dies zu gewährleisten, liegt im Aufgabenbereich des Gemeinwesens – des Rechtslebens. Diese Freiheit darf aber nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden und so kann auch ein Professor an einer Universität letztlich nicht machen, was er will. Ganz gleich, ob man die Vereinsform für unsere Verhältnisse als geeignet ansieht oder nicht (Rudolf Steiner tat dies definitiv nicht!): Die AAG ist ein Verein und wenn wir darin ehrlich und wahrhaftig wirken wollen, kann es auch bei uns nicht anders sein als in einem ehrlich freiheitlich orientierten Staatswesen. Ein wirklich freies Geistesleben entsteht ja nicht dadurch, dass eine selbstgebildete Gruppe die Hochschule und das Goetheanum in einer Art Selbstermächtigung für sich beansprucht, quasi in Besitz nimmt, nach eigenen Regeln agiert und handelt, die Nachfolge ebenfalls nach eigenem Belieben regelt und durchsetzt und behauptet, dass all dies den übrigen Teil des demokratischen Gemeinwesens – die Mitglieder – nichts anginge. 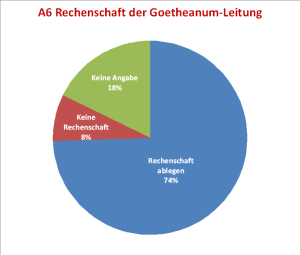
74 % der Befragten sind der Ansicht, dass eine Rechenschaft der Goetheanum-Leitung statuarisch geregelt sein sollte.
Solange das Goetheanum und die Hochschule Bestandteil des Rechtskörpers «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» sind, liegen die Aufgabe der Gesellschaft und die Verantwortung für die innere Struktur – und die Ermöglichung eines freien Geisteslebens – beim Souverän der Gesellschaft, der Mitgliedschaft, vertreten durch die Mitgliederversammlung! Sich daran nicht zu halten, diese eindeutige und unabänderliche rechtliche Gegebenheit nicht zu akzeptieren,[2] führt zwangsläufig zur Bildung von Machtverhältnissen und vor allem in die Unwahrhaftigkeit. Insofern sich Widersprüche zu den aktuellen Statuten ergeben, ist zu überprüfen, inwieweit diese irrtümlich in dem Glauben zustande gekommen sind, bei der AAG handle es sich um die Weihnachtstagungs-Gesellschaft von 1923. Mit der Aufnahme der Goetheanum-Leitung in die Statuten und einer Regelung des Zustandekommens dieses Organs sowie dessen Rechte und Pflichten, wird eine Stärkung deren Position und Aufgabe verbunden sein. Und selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft als Ganzes ein freies Geistesleben in den entsprechenden Bereichen und Belangen zu ermöglichen und zu gewährleisten. Wir sollten darauf vertrauen, dass es möglich sein wird, im offenen und freien Austausch zu den Regelungen zu kommen, die wir brauchen, wenn wir es wollen! Und niemand will ernsthaft ein freies Geistesleben in unserer Gesellschaft abschaffen – das Gegenteil ist der Fall! Thomas Heck
Die Entstehung der Goetheanum-Leitung
(Ergänzter Auszug aus dem Buch «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG»)[3]
Vorbemerkung
Wenn die heutige Goetheanum-Leitung in Verbindung gebracht wird mit der Goetheanum-Leitung, die in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft gemeint war, so ist lediglich der Name gemeinsam, nicht aber der Ursprung und der Anlass der Gründung. Die heutige Goetheanum-Leitung steht in keiner Kontinuität mit der damaligen, sondern ist 2012 entstanden, da die Situation am Goetheanum neu gegriffen werden musste aus einer krisenhaften Situation. So entstand ein neues Organ, welches «im Oktober 2012 auch formal gegründet wurde, unter uns [der Goetheanum-Leitung].» Und weiter: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.»[4] Da es sich um ein neugegründetes Organ handelt, ist es irreführend, wenn in §3 der Statuten der AAG der Eindruck entsteht, die heutige Goetheanum-Leitung stehe als Organ in einer Nachfolge oder einem Zusammenhang mit dem, was in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft gemeint war: «Die im Gründungs-Statut genannte Goetheanum-Leitung umfasst die Vorstandsmitglieder sowie die Leitenden der einzelnen Sektionen der Hochschule, die sich ihre Arbeitsformen selber geben.» (Hinzu kommt, dass es sich bei den hier mit ‹Gründungstatut› bezeichneten Statuten von 1923 keinesfalls um das Gründungsstatut der AAG handelt, denn diese wurde bereits 1913 gegründet.)
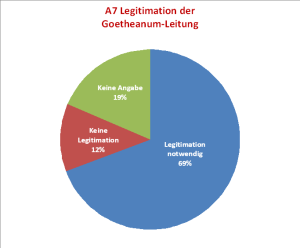 69 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Goetheanum- Leitung einer Legitimierung durch die Mitgliedschaft bedarf.
69 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Goetheanum- Leitung einer Legitimierung durch die Mitgliedschaft bedarf.
Der Vorlauf im Jahr 2011
Es ist erstaunlich, wie sich in gewisser Weise wiederholen sollte, was bereits 2001/2002 geschah – jetzt, im Jahr 2011, nach den Umlaufszeiten geschichtlicher Ereignisse korrespondierend mit der Gesellschaftsgründung von Köln 1912.[5] Wieder boten sich Möglichkeiten der Erneuerung, und das Geschehen war charakterisiert durch zahlreiche Mitglieder-Anträge zur Generalversammlung. Die Antragsteller, die sich für die Gesellschaft engagierten, wünschten mehr Mitsprachemöglichkeiten und sahen das autoritäre Wirken des Vorstandes als unzeitgemäss und unangemessen an.
Misstrauensantrag und Umgestaltung der Vorstandssituation
Besonders ein Misstrauensantrag (Antrag 2.1), verbunden mit der Absicht, die gesamte Vorstandssituation neu zu gestalten, stand im Mittelpunkt und beschäftigte die Mitgliedschaft und die Gesellschaftsleitung bereits Monate vor der Generalversammlung. Nachfolgend der Versuch eines (unvollständigen) Überblicks über die ausführliche Begründung dieses Misstrauens- und Umgestaltungsantrags (siehe AWW 2011/3): Deutlich wurde zum Ausdruck gebracht, dass in dem Wirken des Vorstandes eine zunehmende Veräusserlichung und ein sich Orientieren an erhoffter Anerkennung durch die nichtanthroposophische Aussenwelt gesehen wurde. Es würden keine originären Impulse mehr erarbeitet und anthroposophische Kernanliegen und Aufgaben an den Rand gedrängt. So seien ganze Sektionen wegen personeller Entlassungen nur noch eingeschränkt tätig. Im Bereich der Kunst seien durch Kündigungen schwere Einschnitte erfolgt (Kündigung des Bühnenensembles, Abbau der Sprachausbildung), und im Bereich der bildenden Künste sei die ganze Sektion 2010 stillgelegt worden. Der Verwaltungsapparat sei zu gross, von den 6 Vorständen leite nur noch Paul Mackay eine Sektion, dessen Intention allerdings dahin gehe, diese in eine von aussen gesteuerte Plattform umzugestalten. Das wöchentliche Nachrichtenblatt sei ohne vorherige Konsultation und ohne Beschluss der GV quasi abgeschafft und die [schon 2001 als ungenügend empfundene][6] interne Kommunikation damit massiv reduziert worden. Viele hätten sich aufgrund des Vertrauensverlustes in die Gesellschaftsleitung von der Gesellschaft abgewendet und ihre Unterstützung (auch Spenden) entzogen. Weiterhin wurde die Konzentration der Entscheidungsbefugnis auf wenige Personen kritisiert (Paul Mackay und Bodo von Plato). Es wurde die Machtkonzentration insbesondere bei Paul Mackay thematisiert sowie die Einflussnahme des Vorstandes in Angelegenheiten der Hochschule. Mit Blick auf die Finanzen wurde die zurückgehende Spendenbereitschaft aufgrund des Vertrauensverlustes benannt sowie die Absicht, mittels einer ‹Goetheanum-Stiftung› Finanzmittel aus Finanzmarktgeschäften zu generieren. Erwähnt wurde auch der fragwürdige Vorgang des Verkaufes der Weleda-Partizipationsscheine an einen Investor. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass dem Vorstand die Entscheidungsgewalt über den Weleda-Aktienbesitz an der GV 2010 entzogen worden war.
Eine Initiativgesellschaft sollte entstehen!
Als Gegenreaktion auf diesen «Abwahlantrag» wurde vom Vorstand vorgeschlagen, die Amtszeit für Vorstände zukünftig auf 7 Jahre zu begrenzen, mit der Möglichkeit, sich jeweils neu bestätigen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde von Paul Mackay und Bodo von Plato mit besonders hehren Zielen begründet: So sollten «… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden».[7] Sowie: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht.» Und weiter: «Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden. Das heißt, dass es nicht nur um einen Initiativvorstand geht, sondern auch um eine Initiativgesellschaft. Eine Initiativkultur zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft.»[8] Man hatte im Vorstand gemerkt, «dass es ein Grundbedürfnis der Mitglieder ist, mehr in die Geschehnisse der Gesellschaft und ihre Gestaltung einbezogen zu werden. Rudolf Steiner hat die Mitglieder aufgerufen, tätige Mitglieder zu werden. Wenn dies gelingt, darf die Anthroposophische Gesellschaft als eine Initiativgesellschaft aufgefasst werden. Jedes Mitglied ist eingeladen, seinen spezifischen Beitrag dazu zu leisten. Es entsteht eine gesellschaftliche Kraft, die mehr ist als die Summe der Mitglieder. Eine Kraft, die in der Lage ist, ‹Berge zu versetzen›! Und wäre es nicht ein wunderbares Jubiläumsgeschenk an Rudolf Steiner, diese Kraft verstärkt ins Leben zu rufen?»[9] (Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11.)
Leere Versprechen!
Diese angeblichen Ziele erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Als geradezu taktisches Lügengebäude offenbarten sich diese durch Paul Mackays öffentliches Eingeständnis, als er 2019 zur Begründung seines Antrages zur Aufhebung dieser Amtszeitbeschränkung vorbrachte, dass deren Einführung 2011 lediglich eine (mögliche Über-) Reaktion auf den damaligen Abwahlantrag gewesen sei! Weiter führte er aus, dass schon regelmässig eine Besinnung auf die Vorstandstätigkeit erfolgen solle, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich.[10]
Die Goetheanum-Leitung entsteht (2012)
Mit der Goetheanum-Leitung wurde der AAG ein Leitungs-Organ hinzugefügt, welches statuarisch im Grunde nicht existiert: Es wird zwar in den Statuten erwähnt, nicht jedoch, welche Aufgaben es hat, wie die Verantwortlichkeiten sind, nichts über die Verfahren der Bildung und schon gar nichts über eine Rechenschaftspflicht. Und an genau dieses Organ hat der Vorstand zentrale Leitungsaufgaben delegiert – inklusive der Verantwortlichkeit (aber offensichtlich ohne eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Mitgliedschaft). Welch ein Gegensatz zu den vorjährig verkündeten Zielen! Von Rechenschaft und Transparenz ist in der Geschäftsordnung (die erst 7 Jahre später an einem Ort veröffentlicht wurde, an dem sie kaum jemand gefunden hat, zudem in kurz zuvor modifizierter Form)[11] durchaus die Rede, allerdings nur innerhalb der Goetheanum-Leitung! Untereinander sollen Rechenschaft und Transparenz gepflegt werden, gegenüber der Mitgliedschaft ist dies nicht vorgesehen, die Mitgliedschaft kommt in der Geschäftsordnung im Grunde gar nicht vor. So wird deutlich, dass das, was Paul Mackay ebenfalls sieben Jahre später offenbarte (siehe Seite 3), schon 2012 systematisch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung festgeschrieben wurde. «Die Arbeitsweise der Goetheanum-Leitung im Hinblick auf die Leitung der Hochschule und der Sektionen sowie der Anthroposophischen Gesellschaft wird in Transparenz und gegenseitiger Rechenschaftspflicht wahrgenommen und jährlich evaluiert.»[12] Wie die Goetheanum-Leitung ihr Verhältnis zu den Mitgliedern sieht, wird aus einer unveröffentlichten Beschreibung des Projektes «Goetheanum in Entwicklung» aus dem Jahr 2017 deutlich: «Ein wesentliches Ziel aller genannten Projekte ist es, innerhalb von drei Jahren die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Goetheanum zu erreichen. Die Basis dafür ist das Vertrauen in das Goetheanum und seine Entwicklung. Ein wichtiger Impuls ist in diesem Zusammenhang die Initiative einer verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern. Denn noch immer bleiben weiterhin die Mitgliederbeiträge eine wesentliche Grundlage der Finanzen.»[13]
Keine günstigen Voraussetzungen
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Goetheanum-Leitung – im Verbund mit den Landesvertretern – als die eigentliche Gesellschaft versteht. Von einer Partnerschaft mit der Mitgliedschaft, von «einem neuen sozialen Feld», davon, dass «die Mitgliedschaft mehr einbezogen wird», von einer «verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern», von dem Vertrauen als Basis ist in der Geschäftsordnung einfach nichts zu finden. Die Gestaltungsprozesse für die Bildung der Goetheanum-Leitung fanden im Jahr 2011 statt, genau in dem Jahr, als die Amtszeitbegrenzung der Mitgliedschaft mit hehren – jedoch nur vorgetäuschten – Absichten schmackhaft gemacht worden war, denn in Wirklichkeit wollte man eine Abwahl verhindern. Durch das Eingeständnis Paul Mackays im Jahr 2019 wurde deutlich, dass schon der Bildungsprozess dieses Organs mit unwahren Darstellungen gegenüber der Mitgliedschaft verbunden war. Keine ‹günstigen Voraussetzungen› für eine anthroposophische Gesellschaft. Die offizielle Einführung der Goetheanum-Leitung erfolgte dann 2012, 100 Jahre nach der Gesellschaftsgründung in Köln!
Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung
Mit dem zur Generalversammlung 2024 zur Abstimmung vorgelegten Antrag soll nun die Goetheanum-Leitung auch in den Statuten verankert werden. Dies entspricht dem Wunsch zumindest eines grossen Teiles der Mitgliedschaft, wie eine Umfrage ergeben hat. Bestätigt wurde dies auch durch die 130 Mitunterzeichnungen des Antrages. Allerdings ist der Vorstand der Ansicht, dass die Goetheanum-Leitung für die Gesellschaft keine Verantwortung trage. So wurde in einer Reaktion auf den Antrag von Ueli Hurter und Justus Wittich ausgeführt: «Die Goetheanum-Leitung ist vielleicht das wichtigste Bewusstseins-Organ der Anthroposophischen Gesellschaft, aber es trägt insbesondere und ausdrücklich keine Verantwortung für die Gesellschaft.» Und weiter: «Sie ist nicht zuständig oder verantwortlich für gesellschaftliche Angelegenheiten…». Das ist bemerkenswert, heisst es doch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung: «Die Goetheanum-Leitung ist über alle wesentlichen Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule zu informieren und trifft in übergeordneten Fragen der einzelnen Verantwortungsbereiche Richtungs- und Zielentscheidungen.» Ueli Hurter am 18. Dez. 2023: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.» Ist das nicht eindeutig genug? Thomas Heck, 12. März 2024
Zur Reaktion des Vorstandes auf den Antrag
Die Frage nach einer Verankerung der Goetheanum-Leitung in den Statuten, ist seit 5 Jahren anhängig und wurde bereits an Generalversammlungen eingebracht (2019 und zur ausserordentlichen GV 2023) sowie bei anderen Gelegenheiten angesprochen. Seitens der Leitung hatte man sich jedoch bisher nicht oder lediglich nur mündlich geäussert. Mit der Reaktion auf den Antrag liegt nun erstmals eine schriftliche Reaktion vor, sodass darauf eingegangen werden kann:
- Zunächst wurde mitgeteilt, dass man den Antrag nicht für abstimmungsfähig halte, da er auf falschen Tatsachen beruhe. Wem aber kommt die Deutungshoheit zu, dies zu beurteilen? Wenn der Vorstand die vorgebrachten Argumente für falsch hält, möge er dies der Mitgliedschaft erklären – die Mitgliederversammlung wird dann schon richtig abstimmen.
- Weiter heisst es: «Ihr Antrag geht von einem bestimmten, sich nicht aus den Statuten oder der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung ergebenden Bild aus und widerspricht von verschiedenen Gesichtspunkten aus den Statuten selbst bzw. der Sozialarchitektur von Goetheanum als Hochschule und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.» Ob das so ist, wäre zu prüfen, denn tatsächlich geht u.a. aus der Geschäftsordnung hervor, dass die Goetheanum-Leitung sehr wohl für die Gesellschaft verantwortlich ist, wie bereits oben zitiert und ausgeführt wurde.
- Und weiter: «Zunächst entspricht es nicht den Tatsachen, dass die Goetheanum-Leitung „das wichtigste Leitungs-Organ der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft geworden“ ist», was Ueli Hurter jedoch ganz anders darstellte: der Goetheanum-Leitung sei die Gesamtverantwortung des Vorstandes auch für die Gesellschaft übertragen worden (siehe weiter oben).
- «Die Goetheanum-Leitung ist vielleicht das wichtigste Bewusstseins-Organ der Anthroposophischen Gesellschaft, aber es trägt insbesondere und ausdrücklich keine Verantwortung für die Gesellschaft. Das ergibt sich aus den Statuten sowohl der Weihnachtstagung wie der aktuell gültigen und ich lege Ihnen außerdem die aktuelle Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung von 2020 bei, die von der davor veröffentlichten Fassung nur unwesentlich abweicht.» Dieser Aussage widerspricht die Geschäftsordnung selber, wenn es dort heisst: «Die Goetheanum-Leitung ist über alle wesentlichen Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule zu informieren und trifft in übergeordneten Fragen der einzelnen Verantwortungsbereiche Richtungs- und Zielentscheidungen.»
Es wurde bereits ausgeführt, dass die heutige Goetheanum-Leitung nicht an das anschliesst, was in den Weihnachtstagungs-Statuten gemeint ist, auch wenn die Bezeichnung die gleiche ist. Insofern ist der Verweis auf die damaligen Statuten ungeeignet, eigentlich irreführend. Dass aus den heutigen Statuten die Verantwortlichkeit der Goetheanum-Leitung für die Gesellschaft nicht hervorgeht, ist ja gerade das Problem und als Beweis dafür, dass keine Verantwortlichkeit besteht, vollkommen ungeeignet. Vielmehr handelt es sich dabei um einen gravierenden Mangel, der durch die vorgeschlagene Aufnahme in die Statuten behoben werden soll. An dieser Stelle ist eine grundlegende Bemerkung notwendig: Dem Selbstverständnis der heutigen Leitung von Gesellschaft und Hochschule liegt die irrtümliche Ansicht zugrunde, dass die Hochschule als ein integraler Bestandteil der juristischen Person (Verein nach Schweizer Recht) «Anthroposophische Gesellschaft» gegründet worden sei. Dies ist schon allein deshalb mehr als unwahrscheinlich, weil eine wirkliche Unabhängigkeit der Hochschule als Bestandteil einer unabänderlich basisdemokratische ausgerichteten, nur von Gesetzes wegen existierenden juristischen Person kaum möglich ist bzw. umfangreiche statuarische Regelungen notwendig gewesen wären, die jedoch nicht gegeben waren. Darüber hinaus scheitert diese Ansicht schon daran, dass es sich bei der Weihnachtstagungs-Gesellschaft nicht um einen Verein nach Schweizer Recht gehandelt hat, auch wenn dies immer wieder behauptet wird. So von Justus Wittich und Gerald Häfner im Rahmen der zweijährigen Kolloquiums-Arbeit, die ihre Behauptungen jedoch auch auf mehrfache Bitte hin nicht belegt haben. Von einer wissenschaftlich orientierten Haltung und Vorgehensweise war und ist in dieser Frage nichts zu erkennen, wenn diese Ansicht immer ohne Nachweis wieder behauptet wird und existierende Widerlegungen ignoriert werden. Das mag zunächst genügen, denn es wird bereits deutlich, dass die Goetheanum-Leitung einerseits an einer sauberen Klärung der zugrunde liegenden Fragestellungen offensichtlich nicht wirklich interessiert ist und auf der anderen Seite sehr wohl Verantwortung für die Gesellschaft trägt, was aus eigenen Darstellungen und aus der Geschäftsordnung klar hervorgeht. Aber auch dann, wenn die Goetheanum-Leitung keine Verantwortung für die Gesellschaft tragen soll, müsste dies sauber geklärt und in den Statuten klar formuliert werden, denn die Hochschule und das Goetheanum sind rechtlich Bestandteil des Vereins Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, insofern rechtlich nicht autonom (auch wenn versucht wird, dies anders zu leben) und die Mitgliederversammlung ist dementsprechend rechtlich auch zuständig für diese Bereiche. So ist eine Statutenergänzung in jedem Fall erforderlich. Thomas Heck, 14. März 2024 [1] Auf den möglichen Widerspruch, dass sich innerhalb der Gesamtheit der AAG die Gesellschaft als ein Teil derselben existieren soll, wird hier nicht weiter eingegangen. Es handelt sich um den üblichen Sprachgebrauch, der hier übernommen wird. [2] Selbstverständlich können Aufgaben und Verantwortlichkeiten an Organe delegiert werden. Dies ist in einem Verein jedoch die Aufgabe der Mitgliederversammlung. Die grundsätzlich basisdemokratische Grundstruktur eines Schweizer Vereins ist in letzter Konsequenz unabänderlich. Es ist im Grunde eine Ungeheuerlichkeit, wenn Rudolf Steiner unterstellt wird, er habe mit der Weihnachtstagungs-Gesellschaft einen Verein nach Schweizer Recht gründen wollen, sich jedoch an die gesetzlichen Vorgaben in der weiteren Gestaltung nicht gehalten. [3] Thomas Heck, «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft», Dornach 2023. [4] Zitate in diesem Abschnitt: Ueli Hurter in einer Ansprache zur Goetheanum-Leitung am 18. Dez. 2023, goetheanum.tv. [5] Die Ansicht, es handle sich um 33 1/3 Jahre, kann nicht auf Rudolf Steiner zurückgeführt werden. Eindeutig ist von 33 Jahren die Rede, was dann zu 99 Jahren führt, nicht 100. Rundbriefe 30, Sonderausgabe vom 30. Jan. 2022, Nr. 41. Siehe www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv. Näheres dazu siehe Fussnote 1. [6] Anmerkung TH. [7] «Dokumentation der Anträge», AWW 3/2011. [8] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 5/11 [9] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11. [10] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 1. Jan. 2024). [11] Am 18. Febr. 2020 erfolgte eine erneute Änderung der Geschäftsordnung, die auch 4 Jahre später (12. März 2024) der Mitgliedschaft nicht bekannt ist! [12] Jahresbericht 2018/19, S. 42. [13] Unveröffentlichter Auszug aus einem internen Dokument: https://wtg-99.com/documents/GoetheanuminEntwicklung.pdf
von Thomas Heck | Feb 29, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Sie war Marketingchefin bei Opel und CEO bei der Parfümeriekette Douglas. Nun will die deutsche Managerin bei der anthroposophischen Kosmetikfirma Weleda eine Premium-Linie lancieren und die notorisch defizitäre Arzneimittelsparte profitabel machen. Wie soll das klappen?
Frau Müller, als Chefin der Parfümerie Douglas hatten Sie mit CVC einen Finanzinvestor als Eigentümer im Nacken, bei Weleda sind es die Anthroposophen. Was ist anstrengender? …
Weiterlesen bei der NZZ
von Thomas Heck | Feb 17, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Corona-Aufarbeitung – Kooption
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit dem Jahr 2024 wichtige Entscheidungen anstehen, die für das Zusammenleben der Menschen in Freiheit und Würde entscheidend sein können – gemeint sind hier vor allem die Bestrebungen der supranationalen Institutionen und Bewegungen wie der WHO, One Health, dem World Economic Forum uvm. Besonders im Fokus steht der geplante Pandemievertrag und die Internationalen Gesundheitsregeln (IHR), über die Ende Mai abgestimmt werden soll. Aber auch für unsere Gesellschaft – eine anthroposophische Gesellschaft – deren soziale Verhältnisse und Strukturen vorbildlich sein sollten, stellt sich die Frage, ob an der diesjährigen Generalversammlung ein nachhaltiger und verbindlicher Veränderungsprozess hin zu zeitgemässen und zukunftsweisenden Strukturen etabliert werden kann. Ganz gleich, worauf man blickt: Es wird vor allem darauf ankommen, ob in der Zivilgesellschaft – das ist bei uns die Mitgliedschaft – genügend Veränderungswille zum Tragen kommen kann und das notwendige Engagement entsteht. Ausgehend von den Ergebnissen der Umfrage sollte das eigentlich möglich sein. Was aber kann wirklich realisiert werden?
Ergebnisse der Mitglieder-Umfrage
Es werden hiermit die Ergebnisse der Mitgliederumfrage veröffentlicht, die als Initiative aus einer Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit den Mitgliedforen entstanden ist. Es erreichten uns aus 25 Ländern ca. 330 Antworten – das entspricht 8 – 9% der 3.500 – 4.000 erreichten Adressen. Nach herkömmlichen Massstäben ist das durchaus ein respektables und auch repräsentatives Ergebnis. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 wurde von der Redaktion des damals noch wöchentlich erscheinenden Mitteilungsblattes «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht» eine Leserumfrage durchgeführt. Von den 8.500 Abonnenten antworteten 214 (2,5%). Auch dies war nach üblichen statistischen Grundsätzen durchaus repräsentativ, gewiss immer nur für die befragte Gruppe, nicht die ganze Gesellschaft!
Die Ergebnisse des recht umfangreichen Fragenkataloges sind in einer Präsentation zusammengefasst und können im Internet abgerufen werden (Mit diesem Link [English translation] oder unter www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv) bzw. sind dem Versand dieses Rundbriefes beigefügt.
Die Antwortmöglichkeiten wurden vielfach als zu eingeschränkt erlebt, was in der hohen Anzahl der freien Antworten zum Ausdruck gekommen ist: Insgesamt liegen über 2.000 zum Teil sehr ausführliche Kommentare bzw. freie Antworten vor, bei einigen Fragen haben bis zu zwei Drittel der Befragten die freie Antwortmöglichkeit genutzt – z.B. zur Kommunikation und zur Klimafrage. Die Kommentare konnten für eine Veröffentlichung noch nicht bearbeitet werden.
Ganz herzlich sei allen Teilnehmern gedankt, die sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Der Dank gilt aber auch all denjenigen, die zu dem Zustandekommen dieser Umfrage beigetragen, an dem Fragenkatalog mitgearbeitet und uns zur Durchführung ermutigt haben.
Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung
Die Goetheanum-Leitung ist heute das wichtigste Leitungsorgan der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Es ist allerdings nicht von der Mitgliedschaft legitimiert und Rechenschaft wird lt. Geschäftsordnung (Stand 2019) nur intern, innerhalb der Goetheanum-Leitung abgelegt, nicht gegenüber der Mitgliedschaft. Ganz anderes an der Weihnachtstagung: Rudolf Steiner liess der Besetzung des Leitungs-Organs selbstverständlich zustimmen – wodurch dieses Organ legitimiert wurde. Und ebenso selbstverständlich war in den Statuten vorgesehen, dass jährlich ein vollständiger Rechenschaftsbericht gegeben werden sollte – statutarisch festgelegt (§ 10).
Ist es wirklich zeitgemäss, vorbildlich und angemessen, wenn in unserer Gesellschaft das inzwischen zentrale Leitungsorgan, welches sich aus sich selbst heraus erweitert, ohne Legitimation durch die Mitgliedschaft und ohne eine Vereinbarung zur Rechenschaft gegenüber der Mitgliedschaft besteht? Die Antworten der befragten Mitglieder sind eindeutig.
In diesem Sinne wurde der Lenkungskreis der Mitgliederforen und die Goetheanum-Leitung angeschrieben (siehe E-Mail), denn idealerweise sollte gemeinsam, aus Mitgliedschaft und Leitung, eine Regelung entwickelt werden, die dann von der Generalversammlung bestätigt werden könnte. Nachdem die Goetheanum-Leitung bereits seit 2012 existiert und dieses Problem seit 2019 thematisiert wird, erscheint es nun doch an der Zeit zu handeln. Eine statutarische Verankerung der Goetheanum-Leitung würde zweifellos zu einer Stärkung dieses Leitungsorgans führen. Zudem könnte es zu einem erheblichen Vertrauensgewinn beitragen, wenn dies von der Goetheanum-Leitung selber so gesehen werden würde. In dem hier vorgelegten Vorschlag ist nicht alles detailliert geregelt, damit Spielraum für das Leben bleibt und sich zeigen kann, wie z.B. mit der Frage nach der Rechenschaft umgegangen wird. In diesem Sinne soll als Vorschlag der «Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung» eingebracht werden. Bereits im Vorfeld (bei einer Art Testlauf) haben insgesamt 36 Mitglieder diesen Antrag unterzeichnet. Nun ist die gesamte Mitgliedschaft zur Beteiligung eingeladen, was unter diesem Link erfolgen kann. Dort ist auch eine Unterschriftsliste herunterladbar und die Namen der bisherigen Unterstützer einsehbar, sofern sie der Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Weitere Informationen: («Die Entstehung der Goetheanum-Leitung»).
Corona-Aufarbeitung
Auf die vielfach als problematisch erlebte Haltung der Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und insbesondere der Medizinischen Sektion (sowie weiterer anthroposophischer Institutionen) wurde immer wieder hingewiesen – insbesondere in «Ein Nachrichtenblatt» und in unseren Rundbriefen. Angesichts dieses Verhaltens muss die Frage nach einer Aufarbeitung gestellt werden.
Zwei Drittel der Befragten sind klar der Ansicht, dass es einer Aufarbeitung bedarf. Aus den Kommentaren wird deutlich, dass auch unter denjenigen, die sich dagegen aussprechen, etliche dem Verhalten kritisch gegenüber stehen. Insofern muss uns dieses Thema schon beschäftigen.
Ein Vorschlag, was aufzuarbeiten wäre, wurde im Rundbrief 70 (August 2023) skizziert. Die Reaktionen seitens des Vorstandes beschränkten sich leider auf persönliche Kritik gegenüber dem Autor, auf die Inhalte wurde nicht eingegangen. In Folgegesprächen[1] wurde durchaus eine Aufarbeitung in Aussicht gestellt, es war sogar von einer ‹Wahrheitskommission› nach dem Vorbild in Südafrika zur Aufarbeitung der Apartheit die Rede. Eine entsprechende Ankündigung sollte noch im Dezember 2023 öffentlich erfolgen. Nach Rücksprache mit den Leitungskollegen wurde dies jedoch zurückgenommen, eine Ankündigung ist bisher nicht erfolgt. Aktuell ist die Themengruppe 8 der Mitgliederforen «Kooperationen mit WHO, One Health etc.» mit dem Vorstand im Gespräch. Die bisherigen Erfahrungen stimmen allerdings nicht optimistisch. Insofern wird voraussichtlich in den nächsten Tagen ein entsprechender Antragsentwurf vorgelegt werden. Ein einvernehmliches Vorgehen mit der Leitung würde damit nicht ausgeschlossen und wäre einer kontroversen Abstimmung an der Generalversammlung auf jeden Fall vorzuziehen.
Antrag oder Anliegen zur Vorstands-Kooption?
In Bezug auf das Kooptionsverfahren zur Vorstandsergänzung sind die Ergebnisse aus unserer Umfrage ebenfalls eindeutig: Nur 9 % halten dieses Verfahren ohne Wenn und Aber für richtig, über 80% sehen Veränderungsbedarf: 60 % halten eine Ergänzung des Verfahrens für notwendig, 19 % sind der Ansicht, das Verfahren sei einfach abzuschaffen. Auch wenn letzteres sicherlich keine wirklich sinnvolle Option wäre, ist der Wunsch nach Veränderung zumindest in dem von uns befragten Teil der Mitgliedschaft sehr gross. Es sei daran erinnert, dass das Kooptionsverfahren in dieser generellen Form keineswegs auf Rudolf Steiner zurückgeht, sondern ausgerechnet in dem Krisenjahr 1935, als Ita Wegman und Elisabeth Vreede aus dem Vorstand ausgeschlossen wurden, quasi am Bewusstsein der Mitgliedschaft vorbei unter (irrtümlicher?) Berufung auf die Weihnachtstagung eingeführt wurde («Der Ursprung der Vorstands-Kooption»). So beruht das bestehende Kooptionsverfahren in unserer Gesellschaft auf fragwürdigen Grundlagen und entspricht keineswegs einer zeitgemässen Sozialgestaltung. Auch hier besteht Heilungsbedarf. Bestünde nicht die Möglichkeit, gerade jetzt, wo wir an einem Anfang stehen, unter Partizipation der Mitgliedschaft die weiteren Geschicke unserer Gesellschaft zu gestalten, die vorgesehene Kooption z.B. zunächst auszusetzen und dieses Thema in die Mitgliederforen zur Bearbeitung einzubringen? Dies wäre eine weitere, sehr wichtige vertrauensbildende Geste, wobei die Möglichkeiten des Zusammenwirkens des Vorstands mit der Goetheanum-Leitung in keinerlei Weise beeinträchtigt würden.
In diesem Sinne wurde die Goetheanum-Leitung bereits angeschrieben (Mail vom 4. Februar 2024) – was bisher ohne Reaktion blieb.
Was kann man tun? Denkbar wäre es, an die Möglichkeit eines freiwilligen Verzichts wie hier beschrieben zu erinnern. Dies könnte ergänzt werden durch einen Antrag auf Vertagung, sofern eine Vorstandserweiterung zur Bestätigung auf die Tagesordnung gesetzt würde (ein Eventualantrag).
Denkbar wäre folgende Formulierung:
«Antrag zur Vorstandserweiterung
Angesichts der bestehenden Entwicklungsprozesse in unserer Gesellschaft auch in Bezug auf die Gesellschaftsverfassung wird der Vorstand gebeten, bis auf Weiteres von Vorstandserweiterungen im Kooptationsverfahren zu verzichten.
Die Generalversammlung möge beschliessen, die traktandierte Vorstandserweiterung bis auf weiteres zu vertagen.»
Auch hierzu könnte es in den nächsten Tagen einen konkretisierten Vorschlag geben.
Thomas Heck
[1] Es handelte sich um von Harald Jäckel moderierte Gespräche, an denen seitens des Vorstandes Ueli Hurter und Justus Wittich teilnahmen, seitens der Mitgliedschaft Eva Lohmann Heck, Jens-Peter Manfrass und Thomas Heck. Ursprünglich waren diese Gespräche von Gerald Häfner initiiert und als «Friedensinitiative» bezeichnet worden. Davon wird an anderer Stelle gelegentlich zu berichten sein.
von Thomas Heck | Feb 4, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Darstellung der Ergebnisse mit anschliessendem Gespräch
Nur online am Donnerstag, 15. Februar 2024, 20 Uhr
Anmeldung erforderlich (siehe unten)
In der Umfrage wurden aktuelle und zum Teil in den Mitgliederforen behandelte Themen angesprochen. Ca. 300 Menschen, überwiegend Mitglieder der AAG, haben sich die Mühe gemacht, den doch umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten. Bei allen Vorbehalten, die gegenüber statistischen Auswertungen berechtigt sind, lassen sich damit doch repräsentative Aussagen, bezogen auf die ca. 3.500 – 4.000 Befragten, nach den üblichen Maßstäben treffen. Die Ergebnisse werden an diesem Abend dargestellt und anschliessend veröffentlicht.
Eine Herausforderung stellen die ca. 2.000 zum Teil ausführlichen Kommentare dar, die noch einer Sichtung und einer Veröffentlichung in Auswahl bedürfen.
Ganz herzlich sei allen Beteiligten gedankt, denjenigen, die massgeblich an der Erstellung des Fragenkataloges und der Verbreitung der Umfrage mitgewirkt haben – vor allem aber sei auch denjenigen gedankt, die sich die Zeit für die Beantwortung der Fragen genommen haben!
Anmeldung
von Thomas Heck | Feb 4, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Ein Schicksalsdatum der Gesellschaftsgeschichte
Vortrag mit anschliessendem und Gespräch
Nur online am Donnerstag, 8. Februar 2024, 20 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos – um freiwillige Zuwendungen wird gebeten.
Anmeldung erforderlich
Mit dem 8. Februar 1925 und der nachfolgenden Eintragung des umbenannten Bauvereins als «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» ins Handelsregister war die einheitliche Konstitution, wie von Rudolf Steiner beabsichtigt, abgeschlossen. Dies konnte nach zweijährige Arbeit der Kolloquien zur Konstitution einmütig von der Arbeitsgruppe festgestellt werden und ist so in der Chronolgie festgehalten worden (siehe Chronologie Seite 14, unter B 07).
Gleichzeitig sind jedoch mit diesem Geschehen um den 8. Februar 1925 die wohl wesentlichsten Verwirrungen in Bezug auf die Gesellschaftsgeschichte entstanden, mit einer bis heute bestehenden Wirksamkeit, obwohl die wesentlichen Erkenntnisse bereits Mitte der 1960er Jahre bekannt wurden.
Zum 99sten Jahrestag dieses Schicksalsdatums sollen an einigen Motiven dieses Geschehens die bis heute bestehenden Widersprüchlichkeiten angeschaut werden. Wie aber ist es möglich, dass ein hinreichend dokumentiertes Geschehen auch nach fast 100 Jahren immer noch ganz unterschiedlich bewertet wird? Gibt es möglicherweise (okkulte) Interessen, die einem unbefangenen Erkennen entgegenstehen?
Anmeldung
von Thomas Heck | Jan 1, 2024 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
(Ergänzter Auszug aus dem Buch «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG»)[1]
Thomas Heck, 2022/23
English
Vorbemerkung
Wenn die heutige Goetheanum-Leitung in Verbindung gebracht wird mit der Goetheanum-Leitung, die von Rudolf Steiner in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft benannt wurde, so ist lediglich der Name gemeinsam, nicht aber der Ursprung und der Anlass der Gründung. Die heutige Goetheanum-Leitung steht daher in keiner Kontinuität mit der damaligen, sondern ist 2012 entstanden, da die Situation am Goetheanum neu gegriffen werden musste aus einer krisenhaften Situation. So entstand ein neues Organ, welches «im Oktober 2012 auch formal gegründet wurde, unter uns [der Goetheanum-Leitung].» Und weiter: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.»[2]
Da es sich um ein neugegründetes Organ handelt, ist es irreführend, wenn in §3 der Statuten der AAG der Eindruck entsteht, die heutige Goetheanum-Leitung stehe als Organ in einer Nachfolge oder einem Zusammenhang mit dem, was in den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft gemeint war: «Die im Gründungs-Statut genannte Goetheanum-Leitung umfasst die Vorstandsmitglieder sowie die Leitenden der einzelnen Sektionen der Hochschule, die sich ihre Arbeitsformen selber geben.» (Hinzu kommt, dass es sich bei den hier mit ‹Gründungstatut› bezeichneten Statuten von 1923 keinesfalls um das Gründungsstatut der AAG handelt, denn diese wurde bereits 1913 gegründet.)
Der Vorlauf im Jahr 2011
Es ist erstaunlich, wie sich in gewisser Weise wiederholen sollte, was bereits 2001/2002 geschah – jetzt, im Jahr 2011, nach den Umlaufszeiten geschichtlicher Ereignisse korrespondierend mit der Gesellschaftsgründung von Köln 1912.[3] Wieder boten sich Möglichkeiten der Erneuerung, und das Geschehen war charakterisiert durch zahlreiche Mitglieder-Anträge zur Generalversammlung. Die Antragsteller, die sich für die Gesellschaft engagierten, wünschten mehr Mitsprachemöglichkeiten und sahen das autoritäre Wirken des Vorstandes als unzeitgemäss und unangemessen an.
Misstrauensantrag und Umgestaltung der Vorstandssituation
Besonders ein Misstrauensantrag (Antrag 2.1), verbunden mit der Absicht, die gesamte Vorstandssituation neu zu gestalten, stand im Mittelpunkt und beschäftigte die Mitgliedschaft und die Gesellschaftsleitung bereits Monate vor der Generalversammlung.
Nachfolgend der Versuch eines (unvollständigen) Überblicks über die ausführliche Begründung dieses Misstrauens- und Umgestaltungsantrags (siehe AWW 2011/3):
Deutlich wurde zum Ausdruck gebracht, dass in dem Wirken des Vorstandes eine zunehmende Veräusserlichung und ein sich Orientieren an erhoffter Anerkennung durch die nichtanthroposophische Aussenwelt gesehen wurde. Es würden keine originären Impulse mehr erarbeitet und anthroposophische Kernanliegen und Aufgaben an den Rand gedrängt. So seien ganze Sektionen wegen personeller Entlassungen nur noch eingeschränkt tätig. Im Bereich der Kunst seien durch Kündigungen schwere Einschnitte erfolgt (Kündigung des Bühnenensembles, Abbau der Sprachausbildung), und im Bereich der bildenden Künste sei die ganze Sektion 2010 stillgelegt worden. Der Verwaltungsapparat sei zu gross, von den 6 Vorständen leite nur noch Paul Mackay eine Sektion, dessen Intention allerdings dahin gehe, diese in eine von aussen gesteuerte Plattform umzugestalten. Das wöchentliche Nachrichtenblatt sei ohne vorherige Konsultation und ohne Beschluss der GV quasi abgeschafft und die [schon 2001 als ungenügend empfundene][4] interne Kommunikation damit massiv reduziert worden. Viele hätten sich aufgrund des Vertrauensverlustes in die Gesellschaftsleitung von der Gesellschaft abgewendet und ihre Unterstützung (auch Spenden) entzogen. Weiterhin wurde die Konzentration der Entscheidungsbefugnis auf wenige Personen kritisiert (Paul Mackay und Bodo von Plato). Es wurde die Machtkonzentration insbesondere bei Paul Mackay thematisiert sowie die Einflussnahme des Vorstandes in Angelegenheiten der Hochschule. Mit Blick auf die Finanzen wurde die zurückgehende Spendenbereitschaft aufgrund des Vertrauensverlustes benannt sowie die Absicht, mittels einer ‹Goetheanum-Stiftung› Finanzmittel aus Finanzmarktgeschäften zu generieren. Erwähnt wurde auch der fragwürdige Vorgang des Verkaufes der Weleda-Partizipationsscheine an einen Investor. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass dem Vorstand die Entscheidungsgewalt über den Weleda-Aktienbesitz an der GV 2010 entzogen worden war.
Eine Initiativgesellschaft sollte entstehen!
Als Gegenreaktion auf diesen «Abwahlantrag» wurde vom Vorstand vorgeschlagen, die Amtszeit für Vorstände zukünftig auf 7 Jahre zu begrenzen, mit der Möglichkeit, sich jeweils neu bestätigen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde von Paul Mackay und Bodo von Plato mit besonders hehren Zielen begründet: So sollten «… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden».[5] Sowie: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht.» Und weiter: «Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden. Das heißt, dass es nicht nur um einen Initiativvorstand geht, sondern auch um eine Initiativgesellschaft. Eine Initiativkultur zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft.»[6] Man hatte im Vorstand gemerkt, «dass es ein Grundbedürfnis der Mitglieder ist, mehr in die Geschehnisse der Gesellschaft und ihre Gestaltung einbezogen zu werden. Rudolf Steiner hat die Mitglieder aufgerufen, tätige Mitglieder zu werden. Wenn dies gelingt, darf die Anthroposophische Gesellschaft als eine Initiativgesellschaft aufgefasst werden. Jedes Mitglied ist eingeladen, seinen spezifischen Beitrag dazu zu leisten. Es entsteht eine gesellschaftliche Kraft, die mehr ist als die Summe der Mitglieder. Eine Kraft, die in der Lage ist, ‹Berge zu versetzen›! Und wäre es nicht ein wunderbares Jubiläumsgeschenk an Rudolf Steiner, diese Kraft verstärkt ins Leben zu rufen?»[7] (Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11.)
Leere Versprechen!
Diese angeblichen Ziele erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Als geradezu taktisches Lügengebäude offenbarten sich diese durch Paul Mackays öffentliches Eingeständnis, als er 2019 zur Begründung seines Antrages zur Aufhebung dieser Amtszeitbeschränkung vorbrachte, dass deren Einführung 2011 lediglich eine (mögliche Über-) Reaktion auf den damaligen Abwahlantrag gewesen sei! Weiter führte er aus, dass schon regelmässig eine Besinnung auf die Vorstandstätigkeit erfolgen solle, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich.[8]
Die Goetheanum-Leitung entsteht (2012)
Mit der Goetheanum-Leitung wurde der AAG ein Leitungs-Organ hinzugefügt, welches statuarisch im Grunde nicht existiert: Es wird zwar in den Statuten erwähnt, nicht jedoch, welche Aufgaben es hat, wie die Verantwortlichkeiten sind, nichts über die Verfahren der Bildung und schon gar nichts über eine Rechenschaftspflicht. Und an genau dieses Organ hat der Vorstand zentrale Leitungsaufgaben delegiert – inklusive der Verantwortlichkeit (aber offensichtlich ohne eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Mitgliedschaft).
Welch ein Gegensatz zu den vorjährig verkündeten Zielen.
Von Rechenschaft und Transparenz ist in der Geschäftsordnung (die erst 7 Jahre später an einem Ort veröffentlicht wurde, an dem sie kaum jemand gefunden hat, zudem in kurz zuvor modifizierter Form)[9] durchaus die Rede, allerdings nur innerhalb der Goetheanum-Leitung! Untereinander sollen Rechenschaft und Transparenz gepflegt werden, gegenüber der Mitgliedschaft ist dies nicht vorgesehen, die Mitgliedschaft kommt in der Geschäftsordnung im Grunde gar nicht vor. So wird deutlich, dass das, was Paul Mackay ebenfalls sieben Jahre später offenbarte (siehe Seite 2), schon 2012 systematisch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung festgeschrieben wurde.
«Die Arbeitsweise der Goetheanum-Leitung im Hinblick auf die Leitung der Hochschule und der Sektionen sowie der Anthroposophischen Gesellschaft wird in Transparenz und gegenseitiger Rechenschaftspflicht wahrgenommen und jährlich evaluiert.»[10]
Wie die Goetheanum-Leitung ihr Verhältnis zu den Mitgliedern sieht, wird aus einer unveröffentlichten Beschreibung des Projektes «Goetheanum in Entwicklung» aus dem Jahr 2017 deutlich:
«Ein wesentliches Ziel aller genannten Projekte ist es, innerhalb von drei Jahren die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Goetheanum zu erreichen. Die Basis dafür ist das Vertrauen in das Goetheanum und seine Entwicklung. Ein wichtiger Impuls ist in diesem Zusammenhang die Initiative einer verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern. Denn noch immer bleiben weiterhin die Mitgliederbeiträge eine wesentliche Grundlage der Finanzen.»[11]
Keine günstigen Voraussetzungen
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Goetheanum-Leitung – im Verbund mit den Landesvertretern – als die eigentliche Gesellschaft versteht. Von einer Partnerschaft mit der Mitgliedschaft, von «einem neuen sozialen Feld», davon, dass «die Mitgliedschaft mehr einbezogen wird», von einer «verstärkten Pflege der Beziehung zu den Mitgliedern», von dem Vertrauen als Basis ist in der Geschäftsordnung einfach nichts zu finden. Die Gestaltungsprozesse für die Bildung der Goetheanum-Leitung fanden im Jahr 2011 statt, genau in dem Jahr, als die Amtszeitbegrenzung der Mitgliedschaft mit hehren – jedoch nur vorgetäuschten – Absichten schmackhaft gemacht worden war, denn in Wirklichkeit wollte man eine Abwahl verhindern. Durch das Eingeständnis Paul Mackays im Jahr 2019 wurde deutlich, dass schon der Bildungsprozess dieses Organs mit unwahren Darstellungen gegenüber der Mitgliedschaft verbunden war. Keine ‹günstigen Voraussetzungen› für eine anthroposophische Gesellschaft. Die offizielle Einführung der Goetheanum-Leitung erfolgte dann 2012, 100 Jahre nach der Gesellschaftsgründung in Köln!
Antrag zur Stärkung der Goetheanum-Leitung
Mit dem zur Generalversammlung 2024 zur Abstimmung vorgelegten Antrag soll nun die Goetheanum-Leitung auch in den Statuten verankert werden. Dies entspricht dem Wunsch zumindest eines grossen Teiles der Mitgliedschaft, wie eine Umfrage ergeben hat. Bestätigt wurde dies auch durch die 130 Mitunterzeichnung des Antrages.
Allerdings ist der Vorstand der Ansicht, dass die Goetheanum-Leitung für die Gesellschaft keine Verantwortung trage. So wurde in einer Reaktion auf den Antrag von Ueli Hurter und Justus Wittich ausgeführt: «Die Goetheanum-Leitung ist vielleicht das wichtigste Bewusstseins-Organ der Anthroposophischen Gesellschaft, aber es trägt insbesondere und ausdrücklich keine Verantwortung für die Gesellschaft.» Und weiter: «Sie ist nicht zuständig oder verantwortlich für gesellschaftliche Angelegenheiten…». Das ist bemerkenswert, heisst es doch in der Geschäftsordnung der Goetheanum-Leitung: «Die Goetheanum-Leitung ist über alle wesentlichen Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule zu informieren und trifft in übergeordneten Fragen der einzelnen Verantwortungsbereiche Richtungs- und Zielentscheidungen.» Und wie bereits oben zitiert hatte Ueli Hurter mitgeteilt: «Mit der Gründung und der Einsetzung der Goetheanum-Leitung ist diese Gesamtverantwortung für das Goetheanum, die Gesellschaft und die Hochschule an die Goetheanum-Leitung übergegangen.» Ist das nicht eindeutig genug?
Thomas Heck, 12. März 2024
[1] Thomas Heck, «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft», Dornach 2023.
[2] Zitate in diesem Abschnitt: Ueli Hurter in einer Ansprache zur Goetheanum-Leitung am 18. Dez. 2023, goetheanum.tv.
[3] Die Ansicht, es handle sich um 33 1/3 Jahre, kann nicht auf Rudolf Steiner zurückgeführt werden. Eindeutig ist von 33 Jahren die Rede, was dann zu 99 Jahren führt, nicht 100. Rundbriefe 30, Sonderausgabe vom 30. Jan. 2022, Nr. 41. Siehe www.wtg-99.com/Rundbriefe-Archiv. Näheres dazu siehe Fussnote 1.
[4] Anmerkung TH.
[5] «Dokumentation der Anträge», AWW 3/2011.
[6] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 5/11
[7] Paul Mackay in «Anthroposophie weltweit» 9/11.
[8] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 1. Jan. 2024).
[9] Am 18. Febr. 2020 erfolgte eine erneute Änderung der Geschäftsordnung, die auch 4 Jahre später (12. März 2024) der Mitgliedschaft nicht bekannt ist!
[10] Jahresbericht 2018/19, S. 42.
[11] Unveröffentlichter Auszug aus einem internen Dokument: https://wtg-99.com/documents/GoetheanuminEntwicklung.pdf
von Thomas Heck | Okt 30, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, Zeitgeschehen
WHO – Pandemievertrag und Internationale Gesundheitsregeln (IHR)
Die Entwicklungen der Pandemievertrage und der Internationalen Gesundheitsregeln werden vielfach als Bedrohung der Freiheiten und der Grundrechte der Menschheit erlebt. Diese Problematik wird von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert und sowohl in der nationalen als auch in der europäische Politik werden z.T bereits vorauseilend die Voraussetzungen geschaffen zur Umsetzung der neuen Regelungen. Für den Fall, dass die aktuellen Entwürfe auch nur ansatzweise verbindlich werden, wird der WHO eine beispiellose Macht zugewiesen und man kann zu Recht davon sprechen, dass eine Gesundheitsdiktatur droht.
Da bereits im Mai 2024 sowohl über den Pandemievertrag als auch über die Gesundheitsregeln in der Gesundheitsversammlung der WHO abgestimmt werden soll, ist es höchste Zeit, sich diesem Thema zuzuwenden und – gemeinsam mit anderen Akteuren – sich aktiv dafür einzusetzen, dass diesen Verträgen nicht zugestimmt wird.
In den nachfolgenden aufgezeichneten Ausführungen des Schweizer Rechtsanwaltes Dr. Philipp Kruse und des amerikanischen Unternehmers David E. Martin werden die problematischen Aspekte sowohl dieser Verträge als auch der WHO selber deutlisch aufgezeigt.
Vortrag von Philipp Kruse
Aufzeichnung vom 24. September 2023
Gespräch mit Philipp Kruse und Beiträge von
Dr. med. Christian Pfeffer und Ronald Templeton
Vortrag von David E. Martin
Aufzeichnung vom 12. September 2023
Ort: Eurythmeum Aesch – Schweiz
Aus dem EU-Parlament Strassburg
Aufzeichnungen vom 13. September 2023
Dr. David E. Martin und Dr. Philipp Kruse
von Thomas Heck | Sep 5, 2023 | Allgemein, Zeitgeschehen
Pressekonferenz von Generalsekretär António Guterres am Sitz der Vereinten Nationen
Nachfolgend finden Sie die (übersetzte) Abschrift der Pressekonferenz von UN-Generalsekretär António Guterres über das Klima und die Lage in Niger, die heute (27. Juli 2023) in New York stattfand:
Secretary-General: Ein sehr guter Morgen. Die Menschheit befindet sich in einer heißen Phase. Heute veröffentlichen die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und der Copernicus Climate Change Service der Europäischen Kommission offizielle Daten, die bestätigen, dass der Juli der heißeste Monat in der Geschichte der Menschheit werden wird. Wir müssen nicht bis zum Ende des Monats warten, um das zu wissen. Wenn es in den nächsten Tagen nicht zu einer Mini-Eiszeit kommt, wird der Juli auf der ganzen Linie Rekorde brechen.
Den heute veröffentlichten Daten zufolge hat der Juli bereits die heißesten drei Wochen, die jemals aufgezeichnet wurden, die drei heißesten Tage und die höchsten Meerestemperaturen für diese Jahreszeit erlebt. Die Folgen sind klar und tragisch: Kinder, die vom Monsunregen mitgerissen werden, Familien, die vor den Flammen fliehen, Arbeiter, die in der sengenden Hitze zusammenbrechen.
Für weite Teile Nordamerikas, Asiens, Afrikas und Europas ist es ein grausamer Sommer. Für den gesamten Planeten ist er eine Katastrophe. Und für die Wissenschaftler ist die Sache eindeutig: Der Mensch ist schuld. All dies steht im Einklang mit den Vorhersagen und wiederholten Warnungen. Die einzige Überraschung ist die Geschwindigkeit des Wandels. Der Klimawandel ist da. Er ist erschreckend. Und er ist erst der Anfang.
Die Ära der globalen Erwärmung ist zu Ende, die Ära des globalen Siedens ist angebrochen. Die Luft ist nicht mehr atembar. Die Hitze ist unerträglich. Und das Ausmaß der Profite aus fossilen Brennstoffen und der Untätigkeit beim Klimaschutz ist inakzeptabel. Die führenden Politiker müssen vorangehen. Kein Zögern mehr. Keine Ausreden mehr. Kein Warten mehr darauf, dass andere sich zuerst bewegen. Dafür ist einfach keine Zeit mehr.
Es ist immer noch möglich, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen und das Schlimmste des Klimawandels zu verhindern. Aber nur mit dramatischen, sofortigen Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben einige Fortschritte gesehen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist gut vorangekommen. Einige positive Schritte von Sektoren wie der Schifffahrt. Aber nichts davon geht weit genug oder schnell genug. Der Temperaturanstieg erfordert beschleunigte Maßnahmen.
Vor uns liegen mehrere entscheidende Gelegenheiten. Der Klimagipfel in Afrika. Der G20-Gipfel [Gruppe der 20]. Der UN-Klimagipfel. COP28 [Achtundzwanzigste Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen]. Aber die Staats- und Regierungschefs – und insbesondere die G20-Länder, die für 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind – müssen sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen. Was bedeutet das in der Praxis?
Erstens: Emissionen. Wir brauchen ehrgeizige neue nationale Emissionsreduktionsziele der G20-Mitglieder. Und wir brauchen alle Länder, die Maßnahmen im Einklang mit meinem Klimasolidaritätspakt und meiner Beschleunigungsagenda ergreifen: Die Industrieländer müssen sich verpflichten, die Netto-Null-Emissionen so schnell wie möglich bis 2040 zu erreichen, und die Schwellenländer so schnell wie möglich bis 2050, mit Unterstützung der Industrieländer.
Und alle Akteure müssen sich zusammentun, um einen gerechten und ausgewogenen Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen – während wir die Expansion von Öl und Gas sowie die Finanzierung und Genehmigung neuer Kohle-, Öl- und Gasprojekte stoppen. Es müssen auch glaubwürdige Pläne für den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 für die Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und bis 2040 für den Rest der Welt vorgelegt werden. Die ehrgeizigen Ziele für erneuerbare Energien müssen mit der 1,5°C-Grenze in Einklang stehen. Und wir müssen in den Industrieländern bis 2035 und in den übrigen Ländern bis 2040 eine Netto-Null-Elektrizitätsversorgung erreichen, um allen Menschen auf der Welt erschwinglichen Strom zu bieten.
Wir brauchen auch Maßnahmen von Politikern jenseits der Regierungen. Ich fordere Unternehmen, Städte, Regionen und Finanzinstitute auf, zum Klimagipfel mit glaubwürdigen Umstellungsplänen zu kommen, die vollständig mit dem Netto-Null-Standard der Vereinten Nationen übereinstimmen, der von unserer hochrangigen Expertengruppe vorgestellt wurde.
Die Finanzinstitute müssen ihre Kreditvergabe an fossile Brennstoffe, die Übernahme von Krediten und Investitionen beenden und stattdessen auf erneuerbare Energien umsteigen. Und die Unternehmen, die fossile Brennstoffe einsetzen, müssen ihre Umstellung auf saubere Energie mit detaillierten Umstellungsplänen für die gesamte Wertschöpfungskette planen: Kein Greenwashing mehr. Keine Täuschung mehr. Und keine missbräuchliche Verzerrung der Kartellgesetze mehr, um Netto-Null-Allianzen zu sabotieren.
Zweitens: Anpassung. Wetterextreme werden zur neuen Normalität. Alle Länder müssen darauf reagieren und ihre Bevölkerung vor der sengenden Hitze, den tödlichen Überschwemmungen, Stürmen, Dürren und wütenden Bränden schützen, die daraus resultieren. Die Länder, die an vorderster Front stehen, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben und über die geringsten Ressourcen verfügen, um sie zu bewältigen, müssen dabei die nötige Unterstützung erhalten.
Es ist an der Zeit, die Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel weltweit zu erhöhen, um Millionen von Menschenleben zu retten. Das erfordert eine noch nie dagewesene Koordination der Prioritäten und Pläne der gefährdeten Entwicklungsländer. Die Industrieländer müssen einen klaren und glaubwürdigen Fahrplan vorlegen, um die Anpassungsfinanzierung bis 2025 zu verdoppeln, als ersten Schritt, um mindestens die Hälfte der gesamten Klimafinanzierung für die Anpassung aufzuwenden. Jeder Mensch auf der Erde muss bis 2027 durch ein Frühwarnsystem abgedeckt sein – durch die Umsetzung des Aktionsplans, den wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Und die Länder sollten eine Reihe globaler Ziele in Betracht ziehen, um internationale Maßnahmen und Unterstützung für die Anpassung zu mobilisieren.
Dies führt zum dritten Bereich für beschleunigte Maßnahmen – der Finanzierung. Versprechen, die in Bezug auf die internationale Klimafinanzierung gemacht wurden, müssen eingehalten werden. Die Industrieländer müssen ihre Zusagen einhalten, den Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden Dollar zur Unterstützung des Klimaschutzes zur Verfügung zu stellen und den Grünen Klimafonds vollständig aufzufüllen. Ich bin besorgt darüber, dass nur zwei G7-Länder – Kanada und Deutschland – bisher Zusagen zur Wiederauffüllung gemacht haben. Die Länder müssen auch den Fonds für Schäden und Verluste auf der COP28 in diesem Jahr einsatzbereit machen. Keine weiteren Verzögerungen, keine weiteren Ausreden.
Darüber hinaus belohnen viele Banken, Investoren und andere Finanzakteure weiterhin die Verursacher von Umweltverschmutzungen und schaffen Anreize für die Zerstörung des Planeten. Wir brauchen eine Kurskorrektur im globalen Finanzsystem, damit es beschleunigte Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. Dazu gehört, dass wir einen Preis für Kohlenstoff einführen und die multilateralen Entwicklungsbanken dazu drängen, ihre Geschäftsmodelle und Risikokonzepte zu überarbeiten.
Wir müssen die multilateralen Entwicklungsbanken dazu bringen, ihre Mittel zu mobilisieren, um viel mehr private Finanzmittel zu vertretbaren Kosten für die Entwicklungsländer zu mobilisieren – und ihre Mittel für erneuerbare Energien, Anpassung und Schadensbegrenzung aufzustocken. In all diesen Bereichen brauchen wir Regierungen, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und andere, die partnerschaftlich zusammenarbeiten, um Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich darauf, die Vorreiter und Macher der Beschleunigungsagenda auf dem Klimagipfel im September in New York begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich darauf zu erfahren, wie die führenden Politiker auf die vor uns liegenden Fakten reagieren werden. Dies ist der Preis für den Einstieg.
Die Beweise sind allgegenwärtig: Die Menschheit hat die Zerstörung entfesselt. Das darf uns nicht zur Verzweiflung bringen, sondern zum Handeln. Wir können das Schlimmste noch verhindern. Aber dazu müssen wir das Jahr der brennenden Hitze in ein Jahr des brennenden Ehrgeizes verwandeln. Und wir müssen die Klimaschutzmaßnahmen beschleunigen – jetzt.
Link zum Transkript im Original: https://press.un.org/en/2023/sgsm21893.doc.htm
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dc4LtM-Nbvk&ab_channel=YahooNews
Übersetzung: Mit Deepl.com
von Thomas Heck | Sep 1, 2023 | Allgemein, Zeitgeschehen
30. 08. 2023 | Cornelia Betsch, eine der emsigsten Psycho-Manipulatorinnen für das Impf-Establishment und seinerzeit Mitglied im Corona-Expertenrat, leitet mit ihrer regierungstreuen Erfurter-Psychologentruppe den deutschen Zweig eines EU-Projekts namens Jitsuvax. Es erforscht und verbreitet psychologische Tricks, die Ärzte anwenden sollen, um Impfzurückhaltung zu überwinden.
Der vom Kampfsport Jiu-Jitsu abgeleitete Name des Fünfländerprojekts, das von der Universität Bristol geleitet wird, ist Programm. Denn wie beim Jiu-Jitsu soll der Gegner mit dessen eigener Kraft und seinen eigenen Waffen geschlagen werden. Allein das ist schon auf zwei Ebenen fragwürdig.
Zum einen, weil hier Menschen, die einer bestimmten Impfung gegenüber skeptisch sind, zum Beispiel gegenüber den experimentellen mRNA-„Impfungen“ gegen Covid-19, und dies öffentlich äußern, summarisch als „Gegner“ deklariert und behandelt werden. Ihnen werden generell niedere Motive und unlautere Mittel unterstellt, und außerdem, dass sie auf jeden Fall unrecht haben. Jedenfalls gibt es, soweit ich sehen konnte, nirgends einen expliziten Versuch zu unterscheiden, zwischen zu bekämpfenden unlauteren „Gegnern“ und Menschen, die aus guten Gründen oder irrtümlich skeptisch sind und entsprechend argumentieren, und zwar ohne unlautere Tricks.
Zum anderen, weil das Projekt durchgängig auf psychologische Manipulation setzt, also auf genau das, was man der Gegenseite einfach generell unterstellt. So versteht man offenbar das Jiu-Jitsu-Prinzip, den Gegner mit dessen eigenen Waffen zu schlagen.
Weiterlesen
von Thomas Heck | Mai 18, 2023 | Allgemein, Zeitgeschehen
Die One-Health-Initiative will die Gesundheitsvorsorge vereinheitlichen – dies läuft auf die ungesunde Dominanz einer technokratischen Zentralgewalt hinaus. Ein Beitrag von Willy Meyer aus nichtanthroposophischer Sicht. Die Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autoren und von Manova.
Angesichts der epochalen Herausforderungen, vor denen die gesamte Menschheit steht, empfehlen Regierungen und suprastaatliche Organisationen in jüngster Zeit eine Handvoll rigoroser, teilweise gar drakonischer Konzepte für eine Transformation unserer Gesellschaften. Hierzulande wenig Beachtung fand dabei bisher die One-Health-Initiative, welche die menschliche Gesundheit nicht allein aus medizinischem, sondern auch aus biologischem, sozialem und ökologischem Blickwinkel betrachtet. Der folgende Text fußt auf dem Gespräch zwischen Doktor Meryl Nass und James Corbett auf Children’s Health Defense (1).
One Health – vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit „gemeinsam gesund“ ins Deutsche übersetzt (2) – ist eine noch recht wenig bekannte, dafür sehr umfassende Neuausrichtung der Arbeit der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit äußerst weitreichenden Implikationen für den gesamten Planeten. Die WHO selbst definiert ihren holistisch daherkommenden Ansatz folgendermaßen:
„,One Health’ is an integrated, unifying approach to balance and optimize the health of people, animals and the environment. It is particularly important to prevent, predict, detect, and respond to global health threats such as the COVID-19 pandemic“ (3).
(„Gemeinsam gesund“ ist ein einheitlicher, verbindender Ansatz, die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt im Gleichgewicht zu halten und zu optimieren. Er ist besonders wichtig, um globale Gesundheitsbedrohungen wie die Covid-19- Pandemie zu verhindern, vorauszusagen, zu entdecken und abzuwehren.)
Was zunächst nachvollziehbar und sinnvoll klingt, erscheint doch schnell ominös, wenn schon im zweiten Satz die Corona- Plandemie zur Illustration für die Ausrichtung des One-Health-Ansatzes herangezogen wird.
So ist die WHO auch nicht allein in dem Bemühen, diesem Ansatz weltweit Geltung zu verschaffen; mit im Boot sind die Vereinten Nationen (UN), die EU, die G20-Staaten, die G7-Gruppe und selbstverständlich alle Mitglieder dieser internationalen Zusammenschlüsse. Was sich allerdings konkret hinter dieser blumig formulierten Definition verbirgt, soll das Licht der Öffentlichkeit am besten erst dann erblicken, wenn alle Regularien bis ins letzte Detail festgezurrt und weltweit gesetzlich verankert sind. Vieles davon wird sich aus dem globalen Pandemievertrag ergeben, den die WHO im Dezember 2022 auf der 76. Jahreszusammenkunft aller WHO-Staaten im Mai 2024 auf den Weg zur Verabschiedung gebracht hat.
Erarbeitet werden die darin zugrunde gelegten internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR für International Health Regulations) unter anderem im Intergovernmental Negotiating Body (INB), einer WHO-Kommission, die die unterschiedlichen Vorschläge der Mitgliedstaaten, zumeist hinter verschlossenen Türen, sichtet und der Jahresversammlung zur Abstimmung unterbreitet. Ihr zur Seite steht das aus der Tripartite Executive Annual Meeting hervorgegangene Quadripartite Executive Annual Meeting, ein Zusammenschluss aus der WHO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO), der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) und seit diesem Jahr auch des Umweltprogramms der UN (UNEP), welches sich Ende März 2023 in Genf traf und einen siebenstufiigen Aktionsaufruf für One Health vorlegte, um die Welt sicherer zu machen (4).
Demnach müsse One Health auf der internationalen Politikagenda Priorität eingeräumt werden, insbesondere das Mantra von pandemic prevention, preparedness and response (auf Pandemien ausgerichtete Vorbeugung, Vorbereitung und Abwehr). Auch auf der nationalen Ebene müssen die One-Health-Richtlinien und -Pläne unter der Berücksichtigung des Quadripartite One Health Joint Plan of Action (OHJPA) weltweit vorangetrieben werden.
Die beschleunigte Implementierung der One-Health-Pläne solle erfolgen durch eine One Health governance (technokratisch gebildete OH-Kontrollgewalt) auf nationaler Ebene durch die Einbeziehung von stakeholders (privaten Teilhabern) und durch den Aufbau von Kontrollparametern. Sektorenübergreifende Arbeitskräfte seien aufzustellen, die in der Lage sein sollen, Gesundheitsbedrohungen zu verhindern, zu entdecken, zu kontrollieren und abzuwehren.
Überhaupt sollten Pandemien und Gesundheitsbedrohungen im Keim erstickt werden, wobei es besonders um das zoonotic spillover gehe, den Sprung eines Erregers vom Tier zum Menschen. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Beweise für den One-Health-Ansatz seien zu erschaffen und schließlich müssten Investitionen und Finanzierung für die One-Health-Pläne und -Strategien gesteigert werden.
Dienstbare Wissenschaftler
WHO Generalsekretär Tedros Ghebreyesus fordert zur Umsetzung des One-Health-Ansatzes alle Mitgliedstaaten der WHO auf, in ihren Ländern für Akzeptanz und Durchführung der Richtlinien zu sorgen, da eine Zoonosis wie der – angebliche – Wirtssprung des Coronavirus von einer Fledermaus auf den Menschen überall und jederzeit wieder geschehen kann und damit das Leben aller bedrohe.
Einen wissenschaftlichen Gefälligkeitsdienst leistet ihm dabei eine der international renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, The Lancet, mit dem Artikel After 2 years of the COVID-19 pandemic, translating One Health into action is urgent (Zwei Jahre nach der Covid-19-Pandemie muss OH dringend in Handlung überführt werden) (5), wenn sie schreibt, Covid-19 sei höchstwahrscheinlich („most probably“) durch einen solchen Wirtssprung des Virus aus dem Tierbereich auf den Menschen verursacht worden – und verwirft damit die These eines im Labor mittels Gain-of-Function (Funktionsgewinnforschung auf Basis von genetischer Manipulation) von interessierten Wissenschaftlern scharf gemachten, genmanipulierten Virus.
Drängten nämlich unstrittige Erkenntnisse über einen derartigen Laborursprung an die breite Öffentlichkeit, hätte dies einerseits strafrechtliche Folgen für die daran Beteiligten – in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden unter anderem Anthony Fauci und Christian Drosten –, auf der anderen Seite fiele das Kartenhaus einer tödlichen viralen Bedrohung der Menschheit durch jene Zoonosis schlicht in sich zusammen, womit medizinisch-technokratischen Übergriffen wie der One-Health-Initiative jegliche Berechtigung entzogen wäre.
Um derartigen unkontrollierten Informationsausbrüchen einen festen Riegel vorzuschieben und die globale Angstschraube noch weiter anzuziehen, schreibt The Lancet, dass solche durch neue Pathogene hervorgerufene Krankheitsausbrüche an Häufigkeit zunähmen und deshalb ein übergreifender Ansatz wie One Health unerlässlich sei, schließlich sei alles miteinander verbunden, die Ökosysteme, die Pflanzenwelt, die Wasserwege, die Tiere und die Menschen, und sie alle seien zu ihrem Schutz einer steten Kontrolle zu unterwerfen. Dazu brauche es ein optimiertes Überwachungssystem mit einer Virenüberwachung und einer Früherkennung, sowohl von neuen Varianten als auch von symptomatischen und asymptomatischen Infektionen bei Mensch und Tier. Das würde freilich zu einer absolut umfassenden Testerei von Mensch und Tier führen, der zurzeit noch die in der UN-Charta verankerten Menschenrechte entgegenständen, doch das ließe sich gewiss auch verändern.
Sozioökologische Resilienz
Obgleich es noch an Finanzierung fehle und der gesamte Ansatz wenig konkret sei, weist The Lancet mit einiger Genugtuung auf die positiven Signale zur Unterstützung und Umsetzung von One Health durch die G7 (Gipfel im Juni 2021) und die G20 (September 2021). Die Autoren des Artikels rufen dann dazu auf, resiliente sozioökologische Systeme („resilient socioecological systems“) zu schaffen mit verpflichtenden Bauplänen, vordefinierten politischen Strategien und integrierten privatwirtschaftlichen Akteuren („stakeholders“), da durch Globalisierung bedingte Krankheiten nicht auf nationalstaatlicher Ebene kontrolliert werden könnten. Entsprechend sollen allenthalben regionale One-Health-Netzwerke entstehen, die die Fragen der Lebensmittelnachhaltigkeit, Sicherheit und Resilienz der Bevölkerungen in Anbetracht von Tierkrankheiten und Naturkatastrophen lösen.
Gemeint ist damit im Grunde die Abschaffung der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft, da beide durch ihre CO2-Ausgasung zum vorgeblich menschengemachten Klimawandel beitragen, da sie jedweden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind und da das Vieh anfällig für Ansteckungen durch von wilden Tieren übertragene Erreger sei.
Als Lösung stehen der schnell wachsende In-Door-Farming-Bereich und künstliches, in Petrischalen herangezüchtetes „Fleisch“ sowie die insektenbasierte Lebensmittelindustrie längst bereit. Damit am Ende auch kein Land aus der Reihe tanzt, machen internationale Geldgeber wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds ihre Hilfen von der Implementierung der zu fördernden Praktiken auf nationalstaatlicher Ebene ab.
Flankiert werden müsse die One-Health-Initiative durch Bewusstseinskampagnen („awareness campaigns“) und kontinuierliches Training von Entscheidungsträgern, Lehrern und Meinungsführern der Zivilgesellschaften. Sie müsse in die schulischen Curricula eingearbeitet werden, um früh die angestrebten Verhaltensweisen anzubahnen, ganz so wie im Zusammenhang mit der pseudowissenschaftlich herbeiphantasierten menschengemachten Klimaerwärmung. Es geht also um Indoktrination, Gedankenkontrolle und Steuerung der Bevölkerung durch Schuldgefühle und Existenzängste.
Ein neuer Feudalismus
Entsprechend nimmt es kaum Wunder, dass One Health und Absolute Zero – das von der globalen Technokratie vorangetriebene Vorhaben, alle Energie allein aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen und den von Menschen verursachten CO2-Ausstoß auf Null zu setzen (6) Hand in Hand gehen. Beide basieren auf wissenschaftlich äußerst zweifelhaften Schreckensszenarien und verstehen sich als zum Überleben der Menschheit und des Planeten alternativlos.
Sie postulieren die Notwendigkeit einer radikalen Transformation allen menschlichen Handelns und streben nach der
Errichtung einer supranationalen, von Technokraten geführten – will sagen, demokratisch nicht legitimierten – Zentralgewalt, die sich allenthalben auf public-private-partnerships (öffentlich-private-Partnerschaften) stützt, wodurch der massive Einfluss privater Unternehmen und Gesellschaften auf allgemein verbindliche Regeln und sogar Gesetze festgeschrieben würde.
Der breiten Masse der Erdbevölkerung würde dann nichts mehr gehören, sie müssten „ze bugs“ klaglos verspeisen und ebenso klaglos „glücklich“ sein (7). Es handelt sich mithin um nichts anderes als die Durchsetzung eines neuen Feudalismus, in dem wenige den vielen widerspruchslos ihren Willen aufzwingen könnten. Beispielhaft dafür mag der englische König Charles III stehen, der unlängst seine königliche Zustimmung dazu gab, genetisch bearbeitete („gene- edited“) Lebensmittel von einer Kennzeichnungspflicht auszunehmen (8).
Damit können britische Konsumenten nicht mehr erkennen, wie ihre Nahrung zustande kam. Umgekehrt jedoch reist der Monarch stets im eigenen Flugzeug mit vielköpfiger Entourage – sogar ein königlicher Toilettensitz wird immer mitgeführt – und speist ausnahmslos Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft. Die Heuchelei der Mächtigen hat nämlich viele Gesichter.
Die grausame Kaltblütigkeit der anvisierten Maßnahmen hingegen zeigt sich schon jetzt, wenn beispielsweise in den USA 58 Millionen Hühner, Gänse und Truthähne gekeult werden, um der Ausbreitung der Vogelgrippe zu begegnen.
Um einen Bestand vernichten zu müssen, genügt ein positiver PCR-Test, selbst wenn der betroffene Vogel asymptomatisch ist. Dies sei zum Schutze der Bevölkerung unumgänglich. Tatsächlich gab es in den USA in der jüngsten Vergangenheit genau einen Mann, auf den das Virus übergesprungen sei. Er litt vier Tage unter Erschöpfungssymptomen (9).
Vom unermesslichen tierischen Leid einmal abgesehen führte diese Maßnahme zu einer Verknappung – und Verteuerung – von Hühnerfleisch, Eier und Ähnlichem. Viele Menschen empfinden inzwischen ihre gefiederten Mitlebewesen als Quelle gesundheitlicher Gefahren und weichen auf sogenannte „Just-like“-Produkte aus, die wie Geflügelfleisch schmecken sollen, aber – weitestgehend – pflanzlichen Ursprungs sind. Die Pharmaindustrie ihrerseits kann mit mRNA-Injektionen für Wild- und Zuchtvögel aufwarten, ohne mit starkem Gegenwind rechnen zu müssen.
Problem Mensch
Anthony Fauci, bis Ende 2022 Direktor des NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) und medizinischer Berater mehrerer US-Präsidenten, wurde schon im September 2020 folgendermaßen im Magazin Cell zitiert:
„The COVID-19 pandemic is yet another reminder, added to the rapidly growing archive of historic reminders, that in a human-dominated world, in which our human activities represent aggressive, damaging, and unbalancing interactions with nature, we will increasingly provoke new disease emergences. We remain at risk for the forseeable future. COVID-19 is among the most vivid wake-up calls in over a century. It should force us to begin to think in earnest and collectively about living in a more thoughtful and creative harmony with nature… “ (10).
(Die Covid-19-Pandemie ist ein weiterer Hinweis, der zu dem rasch wachsenden Archiv historischer Hinweise hinzukommt, dass wir in einer Mensch-dominierten Welt, in welcher unsere menschlichen Aktivitäten aggressive, schädigende und störende Interaktionen mit der Natur darstellen, zunehmend neue Krankheitsentstehungen provozieren werden. Wir bleiben auf absehbare Zeit dieser Gefährdung ausgesetzt. Covid-19 zählt zu den heftigsten Weckrufen in mehr als hundert Jahren. Es sollte uns zwingen, damit zu beginnen, ernsthaft und als Gesamtheit darüber nachzudenken, wie wir in einer umsichtigeren und kreativeren Einheit mit der Natur leben können. )
Er nimmt damit die der One-Health-Initiative zugrunde liegenden Annahmen vorweg und setzt durch menschliches Verhalten ausgelöste Pandemien als unvermeidlich gegeben voraus. Fauci übte in den USA seit den 1980er Jahren einen überragenden Einfluss auf die Gesundheitspolitik der Regierung aus. Wie mächtig, korrupt und mit den globalen Eliten verwoben er allerdings wirklich ist, verdeutlicht Robert Kennedy Jr. in seinem Bestseller The Real Anthony Fauci (11).
Schon in den 1970er Jahren warnte der Club of Rome vor dem „Krebsgeschwür“, welches die Menschen für unseren Planeten seien („The earth has a cancer and the cancer is Man.“) (12). In der Eugenik verhaftete, durch das Öl-Geschäft reich gewordene Großindustrielle wie Maurice Strong und David Rockefeller III legten die Grundlagen für die Ängste und Schreckensbilder, die ein Großteil der Menschheit inzwischen internalisiert hat. Zugleich stellten sie die Weichen für den alternativlosen Ausweg, versinnbildlicht in den trügerischen Analysen des Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaveränderungen, 1988 von der UNEP ins Leben gerufen), den Agenden 2020, 2030 und den UN Sustainability Goals (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen).
Natürlich wäre es wunderbar, wenn die Menschheit in Einklang mit der Natur, den Tieren, den Pflanzen, den Meeren, den Landschaften, kurz: der gesamten Schöpfung leben wollte. Es ist auch sehr dringend notwendig, dass wir uns unserer Lage besinnen und aus dem so bequemen digitalen Medien- und Konsumwahn erwachen, der die meisten Menschen fesselt. Als „normal“ empfundene Lebensweisen und Gewohnheiten müssen hinterfragt und losgelassen werden, eine radikale Umkehr ist vonnöten.
Umkehren – aber wie?
Wie wir das erreichen? Gewiss nicht, indem wir uns auf globale Philanthropen und Anführer (Ursula von der Leyen 2020: „Thank you Melinda & Bill for your leadership and dedication! “ (13)), elitäre Clubs wie das Weltwirtschaftsforum oder die Bilderberg-Konferenz, von privaten Geldgebern abhängige internationale Organisationen (UN, WHO, Internationaler Währungsfonds (IMF), Weltbank und Co. ) oder als mildtätig daherkommende Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie GAVI (die „Impfallianz“) oder der World Wide Fund For Nature (WWF) verlassen. Nachhaltige (! ) Veränderung beginnt niemals oben, sondern wächst von der Basis in die Breite und erreicht schrittweise immer mehr Menschen. Beispiele dafür, wie das funktionieren kann, zeigt James Corbett in seinem Format SolutionsWatch vom 12. April 2023 unter dem Titel „Meeting People Is Easy“ (14).
Einen überzeugenden Ansatz für eine nachhaltige Wirtschaft haben Peter Haisenko und Hubert von Brunn mit der „Humanen Marktwirtschaft“ (16) entwickelt. Die „Charta für ein Europa der Menschen und Regionen“ liefert basisdemokratische, matriarchal ausgerichtete Ideen dafür, wie wir Gesellschaft machtfrei, friedvoll und menschenfreundlich gestalten können (16). Nachbarschaftsvernetzungen zu gemeinsamen Tauschaktionen, gemeinsamen Garten- und Landwirtschaftsinitiativen, zum gedanklichen Austausch und schlicht Gemeinschaftsbildung sprießen als zarte Pflänzchen des allmählichen Wandels vielerorts aus dem Boden.
Allen gemeinsam ist ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen und die Erde. Denn nichts kann unabhängig vom anderen gedeihen; ein jedes wirkt sich mittel- und unmittelbar auf seine Umgebung aus.
Ja, wir wollen gemeinsam gesund sein! Gemeinsam mit allem Leben auf unserem Planeten. Dazu wird jedoch ein globaler autokratischer Pandemievertrag (17) ebenso wenig beitragen wie die interessengeleitete One- Health-Initiative.
Die wahre Wirkmacht und die echte Verantwortung tragen wir alle. Ergreifen wir diese Chance in Freiheit und Selbstbestimmung.
Zum Autor:
Willy Meyer, Jahrgang 1963, ist alleinerziehender Vater von drei Kindern und Lehrer. Er lebt in Hamburg und engagiert sich seit zwei Jahren lokal für Aufklärung und gesellschaftliche Veränderung.
https://www.manova.news/artikel/gesund-auf-kommando
Quellen und Anmerkungen:
(1) https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/antihuman-agenda-with-james-corbett/
(2) https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/gesundheit/globale-gesundheit/one-health/one-health-gesundheit-fuer-mensch-tier-umwelt.html
(3) https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
(4) https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/03/27/default-calendar/1st-quadripartite-executive-annual-meeting
(5) https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2901840-2
(6) https://netzeroclimate.org/what-is-net-zero/
(7) https://www.youtube.com/watch?v=KTcPxlvXa9I
(8) https://www.reddit.com/r/bestconspiracymemes/comments/12n197q/rules_for_thee_but_not_for_me_king_charles_just/
(9) https://www.nytimes.com/2023/03/06/us/politics/bird-flu-vaccine-chickens.html
(10) https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2931012-6
(11) Robert Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci. Children‘s Health Defense 2022.
(12) https://www.churchmilitant.shop/Research-Material/04-Global_Warming/resources/143.pdf
(13) https://twitter.com/vonderleyen/status/1257672436239282178?lang=de
(14) https://www.corbettreport.com/category/solutions/
(15) https://www.youtube.com/watch?v=5qneieNBs_w oder als Buch: Peter Haisenko und Hubert von Brunn, Die Humane Marktwirtschaft, Anderwelt Verlag 2022.
(16) https://charta-demokratiekonferenz.org/
(17) Dazu die Bürgerinitiative zum Stop: https://citizengo.org/de/node/210669
von Thomas Heck | Apr 17, 2023 | Allgemein
Am 5. Mail 2023 beginnt das erste Dialogforum zu den an der Generalversammlung 2023 beschlossenen Entwicklungsprozessen der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Die Teilnahme ist in Dornach vor Ort oder online möglich. Unter nachfolgendem Link finden Sie die Einladung un die Links zu Anmeldung. Es ist empfehlenswert, sich bereits auch jetzt anzumelden, wenn eine Teilnahme am ersten Termin nicht möglich ist, damit man an dem Informationstrom angeschlossen ist.
Zur Einladung und Anmeldung
von Thomas Heck | Apr 16, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft

3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG
Eine Materialsammlung
Thomas Heck
Probelesen
Das Buch enthält eine Sammlung von einzelnen Beiträgen zur aktuellen Situation der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft unter Berücksichtigung von Rudolf Steiners Hinweisen zum 33-Jahres-Rhythmus (Umlaufszeiten historischer Ereignisse):
• Krisen-Aspekte der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule.
• Der auf der Dauer des Christus-Jesus-Lebens beruhende 33-Jahres-Rhythmus insbesondere im Zusammenhang mit den Gesellschaftsgründungen Rudolf Steiners und den sich daraus ergebenden Zeitreihen (z.B. 1923 – 1956 – 1989 – 2022).
• Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Jahren 2001 und 2011 (3 x 33 Jahre nach den Gründungen von 1902 und 1912), in denen wesentliche Erneuerungsimpulse sichtbar wurden, die sich jedoch nicht verwirklichen konnten und stattdessen im 100sten Jahr sich autoritative durchsetzten.
• Weitere Themen sind u.a. Corona und die ‹offizielle Anthroposophische Medizin›, die Entwicklungsrichtung der Weleda, das Verhältnis Mitglieder – Gesellschaftsleitung, der Umgang mit der Identitätsfrage der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (Konstitutionsfrage) und eine Initiative zur Revision der Gesellschaftsverfassung.
256 Seiten, 18 € / CHF
Probelesen
(Versand in DE und CH 4 € / CHF)
Bestellung: thomas.heck@posteo.ch
Im Buchhandel: Books on Demand
ISBN 9-783-7431-3371-6
von Thomas Heck | Mrz 27, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Dieser Hinweis bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit Peter Selg, die an der ausserordentlichen Generalversammlung am 15. Jan. 2023 entstanden ist.
Ich hatte auf diese Angelegenheit vor der kommenden Generalversammlung nicht mehr eingehen wollen, um – gestützt auf einen Rat von professioneller Seite – nicht zu einer Eskalation beizutragen. Aufgrund mehrfachen Drängens, auf eine am 15. März erschienene Stellungnahme Peter Selgs hinzuweisen, welches von verschiedenen Personen erfolgte, die offensichtlich zum Umkreis Peter Selgs gehören, sehe ich mich nun in gewisser Weise dazu genötigt. Ich hoffe sehr, dass dies zur Versachlichung und Beruhigung beitragen kann. Und ich plädiere sehr dafür, die bevorstehende Generalversammlung, die in einer kritischen Situation stattfinden wird und auf der zukunftsweisende Beschlüsse gefasst werden sollen, nicht mit dieser – inzwischen doch mehr persönlichen – Auseinandersetzung zu belasten.
Da in dieser Stellungnahme die inzwischen von mir erfolgten Widerlegungen nicht einmal erwähnt und die diffamierenden Aussagen pauschal bekräftigt wurden, erscheint mir eine Erinnerung an den ursächlichen Sachverhalt notwendig und gerechtfertigt.
Zum Sachverhalt
In der von Georg Soldner mitunterschriebenen und damit mitverantworteten Einladung zum Mitgliederforum vom 21. Nov. 2023 hiess es:
«Es besteht die Befürchtung, dass die Anthroposophie von Seiten des Staates und der Medien in eine Ecke gestellt wird, die nicht dem entspricht, wofür sie steht. Die Goetheanum-Leitung sucht daher mit ausgesuchten und anerkannten internationalen Einrichtungen zu kooperieren, wodurch sich positive Synergieeffekte ergeben könnten.»
Von wem diese Formulierung stammt, ist unerheblich. Die Unterzeichner tragen die Verantwortung und Georg Soldner hätte wohl kaum unterzeichnet, wenn die Formulierung nicht zutreffend gewesen wäre.
Aus dieser und anderen Mitteilungen (die ich im Rundbrief 61 zitiert habe) ergibt sich unzweideutig das Bild, dass es sich um einen Ent- oder Beschluss der Goetheanum-Leitung handelt, mit diesen Organisationen (hier WHO und «One Health») zu kooperieren, um die Anthroposophie zu schützen. Darauf hatte ich bereits vor dem 15. Jan. 2023 schriftlich und mündlich verschiedentlich hingewiesen, ohne dass ein Widerspruch, eine Richtigstellung oder eine Korrektur erfolgte. Diese Aussage hatte ich an der ausserordentlichen Generalversammlung wiederholt und wurde darauf hin – ohne jede Rückfrage, worauf diese Aussage gründet – von Peter Selg der bewussten Falschbehauptung bezichtigt – «nahe im Bereich der Demagogie». Wenn die personelle oder sektionsbetreffende Zuordnung solcher Aussagen von der Goetheanum-Leitung in keiner Weise kenntlich gemacht wird, sondern diese unter «Goetheanum-Leitung» veröffentlicht werden, ist es absolut unberechtigt, mich der Falschbehauptung zu bezichtigen, gar «nahe im Bereich der Demagogie», zumal es von Peter Selg selbst eine sehr ähnliche Aussage gibt (siehe Rundbrief 61). In der Folge, weil ich den Begriff Funktionär benutzt hatte, sprach er mir ab, mich auf Rudolf Steiner und die Anthroposophie berufen zu dürfen, ich sei deshalb «nicht nur weit hinter die Weihnachtstagung zurückgefallen, sondern hinter die Anthroposophie selber, auch hinter Rudolf Steiner.»
Auf den Vorgang bin ich in meinem Rundbrief 61 eingegangen und habe das von Peter Selg Gesagte im Wortlaut wiedergegeben, nebst einem offenen Brief von Ilona Metz und einer Richtigstellung. Was Peter Selg der Autorin des offenen Briefes unterstellt, grenzt erneut mindestens an üble Nachrede, da die Äusserungen geeignet sind, sich abträglich auf das Ansehen der Autorin, insbesondere ihr Bild in der Öffentlichkeit, auszuwirken. So wäre wiederum eine Richtigstellung auch hier erforderlich
Es steht im Raum, dass ich durch die Veröffentlichung des Transkriptes gegen Persönlichkeitsrechte verstossen habe. Das tut mir leid. Ich fühlte mich allerdings aufgrund der diffamierenden und vor allem unrichtigen Behauptungen Peter Selgs dazu berechtigt, um das Gesagte nachweisen und richtigstellen zu können.
Da die Stellungnahme Peter Selgs an der Generalversammlung in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft geschah, hatte ich mich zur Veröffentlichung des Transkripts entschieden, nebst einer Richtigstellung von mir und des offenen Briefes, den Peter Selg zuvor per Post erhalten hatte. So ist es jedem möglich, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Das gilt leider nicht für die Veröffentlichung von Peter Selgs Stellungnahme auf der Internetseite des Goetteanums, in der zwar als Quelle des offenen Briefes der Rundbrief 61 genannt wird, aber bis heute (Stand 28. März 2023) eine Verlinkung nicht erfolgt ist, sodass dem Leser nicht ohne weiteres zugänglich ist, worauf sich seine Stellungnahme bezieht.
Ich aber wurde inzwischen, wie schon erwähnt, offensichtlich aus Peter Selgs Umkreis vier Mal gebeten und auch gedrängt, seine Stellungnahme bzw. den Hinweis darauf zu veröffentlichen bzw. zu verlinken.
Die Stellungnahme von Peter Selg ist auf der Internetseite des Goetheanums erschienen, gleich auf der Startseite in der Rubrik «Nachrichten».
Für eine Klärung der offenen Punkte zwischen Peter Selg und mir stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Thomas Heck, Dornach, 28. März 2023
von Thomas Heck | Mrz 27, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Schon seit längerem ist zu beobachten – und wurde auch aus der Mitgliedschaft kritisiert – dass man vom Goetheanum sich in Vielem dem sogenannten Mainstream anpasst, bis hin zur Kooperationen mit ausgewiesenen Gegnern Rudolf Steiners. Dazu gehört z.B. die inbesondere in ihren Beurteilungen fragwürdige SKA ( Steiner Kritische Ausgabe) von Christian Clement, die Hofierungen von Helmut Zander und …, die Gutheissung der Verbindungen mit den „Steiner Studies“[1]. In diesem Zusammenhang ist auch die Faust-Inszenierung von 2016 zu sehen und die Übernahme und Verwendung des mehr als fragwürdigen Narrativs „Verschwörungstheoretiker“ zu nennen.[2] Auch in Bezug auf die Ursachen der (angeblichen bzw. vermeintlichen oder tatsächlichen) Klimaveränderung sowie in der sogenannten Corona-Impfung ist man weitgehen den offiziellen Ansichten gefolgt, auch wenn im letzteren Fall eindeutige Aussagen Rudolf Steiners dem entgegenstehen.
Bereits an der Generalversammlung 2022 wurde angesichts der vermehrten Angriffe auf die Anthroposophie und anthroposophische Institutionen davon gesprochen, dass man Allianzen mit nicht-anthroposophischen Bewegungen eingehen müsse und wolle – zum Schutz der Anthroposophie – z.B. mit der Homöopathie. Ich erinnere entsprechende Aussagen von Matthias Girke und Ueli Hurter.
Georg Soldner: «Es wird so sein, dass dieses Jahr Weleda und Wala viel von ihren Fertigarzneimitteln streichen müssen; wir erleben schmerzhafte Verluste, wir erleben eine grosse Krise, wir erleben aber auch neues Interesse und wachsende Begeisterung für die Möglichkeiten, die unsere Medizin bietet im Einklang mit einer neuen Bewegung für ‘planetarische Gesundheit’ und ‘One Health’ […]»[3]
Wolfgang Held berichtete von der Generalversammlung:
«Bei den exemplarischen Darstellungen aus der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft sprach Peter Selg über die Arbeit der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion. Dabei empfahl er mit Bezug auf Martin Buber, Anthroposophie mit ihr nahestehenden Strömungen und Persönlichkeiten zu verbinden. Das würde sie schützen, denn den jüdischen Philosophen beispielsweise würde man nicht ins Visier nehmen.»[4]
Am 21. November 2022 fand am Goetheanum ein Mitgliederforum zu «One Health» statt. Aus der Einladung:
« Es besteht die Befürchtung, dass die Anthroposophie von Seiten des Staates und der Medien in eine Ecke gestellt wird, die nicht dem entspricht, wofür sie steht. Die Goetheanum-Leitung sucht daher mit ausgesuchten und anerkannten internationalen Einrichtungen zu kooperieren, wodurch sich positive Synergieeffekte ergeben könnten.»[5]
In „Was in unserer Gesellschaft noch vorgeht»[6] hatte ich geschrieben:
«Mit der Einladung zu dem Mitgliederforum am 21. November 2022 am Goetheanum ist nun erstmals klar und deutlich – vor allem schriftlich – zum Ausdruck gebracht worden, dass diese Kooperationen gewollt und bewusst eingegangen werden – man hofft, so die Anthroposophie vor Angriffen schützen zu können! Dies kann für die Substanz der Anthroposophie nur zerstörerisch wirken. Nach aussen hin scheint man sich innerhalb der Leitungskreise einig zu sein, diesen Weg konsequent weitergehen zu wollen. Oder gibt es dort doch noch Menschen, die die zahlreichen Bedenken vieler Mitglieder teilen? Bei der Weleda ist diese Anpassung an den Mainstream sehr weit fortgeschritten, wie aus dem Geschäftsbericht 2021 zu entnehmen ist.»
Die Einladung war mitunterschrieben von Georg Soldner. Damit war erstmals schriftlich bestätigt, dass es einen gemeinsamen Ent- oder Beschluss der Goetheanum-Leitung in besagter Richtung gegeben haben muss. Da die Medizinische Sektion den Rundbrief regelmässig erhält, wäre eine Richtigstellung zu erwarten gewesen. Es gab keine Reaktion.
Am 27. Nov. 2022 hatte ich an der Dreigliederungstagung im Abschlussplenum auf diesen Beschluss hingewiesen. Gerald Häfner wandte ein, dass dies nur die Medizinische Sektion betreffe. Offensichtlich kannte er diese Einladung nicht. Weiteres wurde von ihm nicht geäussert.
Erst Peter Selg behauptete am 15. Jan. 2023 (siehe Rundbrief 61), die Behauptung, dass es einen solchen Beschluss gäbe, sei „eine bewusste Falschaussage“.
Thomas Heck, 15. März 2023
[1] „Ein Nachrichtenblatt“ Nr. 21, 23 / 2019. Rundbrief Nr. 11/2019,
[2] «Die offene Anthroposophie und ihre Gegner», „Anthroposophie weltweit“ 7-8/18.
[3] «Ein Nachrichtenblatt» 14/2022.
[4] «Anthroposophie weltweit», 5/2022.
[5] Hervorhebung TH.
[6] Rundbrief Nr. 47 vom 17. Nov. 2022.
von Thomas Heck | Feb 22, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Mit der Veröffentlichung der Tagesordnung zur ordentlichen Generalversammlung 2023 der AAG wurde deutlich, dass seitens der Gesellschaftsleitung an der Befestigung der einheitsstaatsähnlichen und aristokratischen Struktur der Gesellschaft nicht nur festgehalten wird, sondern diese weiter verstärkt werden soll. So setzt sich fort, was schon seit längerem als Entwicklung zu beobachten ist. Zu erkennen ist dies einerseits an der strukturellen Entwicklungsrichtung, die insbesondere aus dem Wunsch nach der Etablierung des Landesrepräsentanten-Organs hervorgeht, sowie den Anträgen von Michaela Glöckler und Uwe Werner. Andererseits spricht die Zeitplanung eine klare Sprache: für eine angemessene Behandlung der Mitgliederanliegen und -anträge wird die dafür vorgesehene Zeit kaum ausreichen. (Für die Antragsteller ist ein Vorgespräch mit dem Vorstand für den 13. März 2023 anberaumt, da, so in der Einladung, die Zeit wohl nicht für alle Anträge und Anliegen reichen würde).
Viel Raum dagegen haben vor allem die Beiträge der Leitenden. So kann der Eindruck entstehen, dass die Generalversammlung als eine Vorstandsveranstaltung verstanden wird, in welcher die Mitgliedschaft eine überwiegend passive Rolle einnimmt. Tatsächlich aber ist es eine Mitgliederversammlung, die der Vorstand organisiert und eine Tagesordnung vorschlägt. Bei uns jedoch scheint eine aktive Mitgliederbeteiligung nicht erwünscht zu sein, nicht leitungskonforme Beiträge schon gar nicht. Wäre es nicht zeitgemäßer, wenn zum Beispiel die Gedanken und Ideen der Gesellschaftsleitung zur Entwicklung der «Weltgesellschaft» unabhängig von der Generalversammlung über die Kommunikationswege der Gesellschaft verlautbart würden, ergänzt um Beiträge von Mitgliedern? Diese könnten anschliessend z.B. in Dialog-Foren bewegt und besprochen werden – gerne mit den Leitenden selber. An der Generalversammlung selber könnte so ein vorbereiteter Freiraum zum weiteren Austausch entstehen.
Angesichts der Tatsache, dass jetzt einerseits die Gegen-Impulse von 100 Jahre nach dem Brand und andererseits die positiven Impulse von 3 x 33 Jahren Weihnachtstagung wirksam sind, ist es nicht verwunderlich, dass sowohl Restaurations- als auch Erneuerungsbestrebungen (letztere durch die Mitgliedschaft) aufeinander stoßen. (Dazu sei auf die phänomenologische Untersuchung der Jahre 2001/2 und 2011/12 in meinem Buch und in frühen Rundbriefen verwiesen).[1] Und wir stehen vor der Frage, ob sich dieses Mal die Erneuerungs- oder, wie häufig zuvor, vor allem die Restaurationskräfte durchsetzen können, ganz ähnlich wie es auch in den weltpolitischen Verhältnissen aktuell der Fall ist: werden sich die weiteren Versuche in Richtung einer schon vor Jahrzehnten angekündigten Welt-Regierung realisieren können, indem zum Beispiel der Kompetenzbereich der WHO durch die aktuell diskutierten Änderungen der Gesundheitsvorschriften (Pandemievertrag) erweitert wird?[2] Sowohl aus der weltpolitischen Lage als auch in unseren Verhältnissen wird sich nur dann etwas im zeitgemäßen Sinne entwickeln können, wenn von der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft, oder bei uns von der Mitgliedschaft Verantwortung für die weitere Entwicklung zumindest mit-übernommen wird. Das heisst: wenn soziale Gestaltung eine Sache all derer würde, die daran verantwortlich mitwirken wollen. Die Zeiten, in denen es angemessen war, dass alles «von oben» geregelt wird, sind endgültig vorüber. Das Ringen um diesen so dringend notwendigen Paradigmenwechsel hat bereits in den letzten Jahrhunderten zuhauf zu Kriegen, Konflikten und Blutvergießen geführt. Gerade auch 1923/24, vor 99 bzw. 100 Jahren, stellte sich die Frage, welche der beiden okkulten Bewegungen sich durchsetzen würde: die soratisch-nationalsozialistische oder die anthroposophische. Wie das ausgegangen ist, wissen wir. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass auch wir heute gerade auf weltpolitischer Ebene in einer Auseinandersetzung mit genau diesen okkulten Kräften stehen – jetzt jedoch global![3]
Mit Blick auf unsere Gesellschaftsverhältnisse stehen wir vor der Entscheidung, ob wir noch zu einer zeitgemäßen und liberalen Gestaltung kommen können und wollen, in der die Initiativen aller Mitglieder wirksam werden können und willkommen sind – auch dann, wenn sie nicht dem Wunsch der Leitung entsprechen. Oder ob es bei der einheitsstaatsähnlichen Struktur bleiben wird, von der man glaubt, sie sei auf Rudolf Steiner zurückführbar. (Davon zeugen insbesondere die bereits oben genannten Anträge von Michaela Glöckler und Uwe Werner). Dies allerdings erweist sich bei näherer Betrachtung sowohl als Anmassung (indem man sich auf eine Stufe stellt mit Rudolf Steiner) als auch als Fiktion, in dem dogmatisiert wurde, was nur für die damaligen Verhältnisse mit Rudolf Steiner gelten konnte (z. B. Initiativvorstand oder Kooptation, wobei letzteres gar nicht auf Rudolf Steiner zurückgeht).
Was können wir tun?
Braucht die Gesellschaft wirklich ein weiteres Leitungsorgan in Form der Konferenz der Landesrepräsentanten? Wäre es nicht zeitgemässer, wenn ein Mitgliederorgan entstehen würde? Oder mehrere? Als Partner der Gesellschaftsleitung auf Augenhöhe? Auf diesem Wege könnte in die Gesellschaft einfliessen, was in der Mitgliedschaft lebt! (Solche Organe müssten sich allerdings, um unabhängig zu sein, aus Mitglieder-Initiativen entwickeln.) Dieser Gedanke liegt der Idee für eine Mitglieder-Verantwortung-Initiative zugrunde, welche an der Generalversammlung am 15. Jan. 2023 erwähnt wurde. Damit soll ermöglicht werden, dass auch von der Mitgliedschaft real (Mit-)Verantwortung für die Angelegenheiten der Gesellschaft, der Hochschule und auch der Repräsentanz der Anthroposophie in der Welt zu übernommen werden kann. Von einem Bedürfnis nach unrechtmäßiger Selbstermächtigung oder dem Wunsch nach Funktionärstum, wie es uns an der ausserordentlichen Generalversammlung vorgeworfen wurde, kann aus der Sache heraus keine Rede sein, denn dies liegt dem Initiativprinzip schon aus sich heraus fern: Nur wenn genügend zustimmende Resonanz entsteht, kann eine Initiative überhaupt wirksam werden, ansonsten ist sie «ein Nichts». Dieses Prinzip lag auch der Neugründung und der Übernahme der Gesellschaftsleitung durch Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung zugrunde! (Siehe hierzu „Hat Rudolf Steiner für einen Initiativvorstand plädiert?“, Rundbrief Nr. 541).
Vorbereitung der ordentlichen GV
Angesichts von 24 Anträgen (ca. 50 Seiten Material) sowie der übrigen wichtigen Themen, die an der Generalversammlung zu verhandeln sein werden, wird es kaum möglich sein, sich erst an der Versammlung die notwendigen Urteilsgrundlagen zu verschaffen. Da wir mit dem Vorbereitungstreffen vom 14. Jan. 2023 zu der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Jan. 2023 gute Erfahrungen gemacht haben, wollen wir dies nun auch überregional ermöglichen: online, per Zoom-Konferenz. Konkret kann das so aussehen, dass dies in maximal 90-minütigen Sitzungen erfolgt, bei denen im Anschluss an einen oder mehrere kürzere Beiträge zum Einstieg, je nach Thema und Anzahl der Teilnehmer, sich eine Fragenbeantwortung oder auch ein Gespräch anschliessen kann. Das ist noch Neuland und es muss sich zeigen, welcher Bedarf besteht.
Vorgesehene Termine und Themen
(Da am 13. März der Vorstand die Antragsteller zu einer Vorbesprechung eingeladen hat, sind die ersten drei Termine wichtig, um in Erfahrung zu bringen, welche Prioritäten und Bedürfnisse unter den Mitgliedern leben. Dies kann dann gegebenenfalls in die Überlegungen an dem Treffen einfliessen.)
Ansonsten sind die Themen als Vorschlag zu verstehen und können bei Bedarf geändert oder ergänzt werden.
Donnerstag, 23. Febr. 2023
(alle Termine 20 – 21 Uhr 30)
Einführung, Die vorgeschlagene Tagesordnung der GV, grundsätzliche Fragen, Anträge und Anliegen.
Fragen der Teilnehmer
Brauchen wir ein Mitglieder-Organ?
Grundsätzliches zum Antrag zur Weleda.
Dienstag, 28. Februar 2023
Was ist ein Gesellschafts-Organ?
Ist die Konferenz der Landes-Repräsentanten ein Organ?
Ist die Goetheanum-Leitung ein Gesellschafts-Organ, welches in den Statuten verankert sein sollte?
Fragen zur Rechenschaft.
Kurze Geschichte und Hintergründe zur Entstehung der Gotheanum-Leitung.
Donnerstag 9. März 2023
Kommunikation in der Gesellschaft
Ungenügende Kommunikationsmöglichkeiten, insbesondere für Mitglieder. Abschaffung des Nachrichtenblattes. Einseitige Berichterstattung. Forderungen des Antrages und weitere Erfordernisse für eine angemessene Kommunikation.
Weitere Termine
Die Themen sind noch offen, Vorschläge sind willkommen.
Donnerstag 16. März 2023 und bei Bedarf:
Donnerstag 23. März sowie
Dienstag, 26. März 2023
Anmeldung
Bitte melden Sie sich über den folgenden Link an. Dort können Sie zu den einzelnen Terminen bzw. Themen auch Kommentare, Fragen oder Wünsche hinterlegen, die dann nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Zur Anmeldung
[1] «3 x 33 Jahre Weihnachtstagung und die Krise der AAG», Dornach 2022, zu beziehen beim Autor und im Buchhandel: Books on Demand, ISBN 9-783-7431-3371-6 (ab 6. März 2023). Siehe dazu auch diverse Rundbriefe: www.wtg-99.com, Rundbriefarchiv.
[2] «One Health»- «One World» – «One World Government», Rundbrief 46, www.wtg-99.com.
[3] Weltregierung z.B. aktuell: https://transition-news.org/weltregierung-und-zukunftsvisionen oder https://www.epochtimes.de/politik/ausland/elon-musk-warnt-vor-weltregierung-und-unkontrollierter-ki-a4159898.html
von Thomas Heck | Jan 4, 2023 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Was denken Betroffene zu den Streichungen des Weleda-Heilmittelsortimentes?
Ein zunächst offener Brief, der zu der «Petition zum Erhalt der Heilmittel der Anthroposophischen Medizin bei der Weleda» führte, wurde innerhalb von gerade einmal 3 Tagen von ca. 1.000 Unterstützern unterzeichnet, eine unerwartet starke Reaktion. Mit diesem Stand wurde die Petition am 19. Dezember 2022 an die Verantwortlichen der Weleda, dem Verwaltungsrat, der Goetheanum-Leitung und der Medizinischen Sektion übergeben. Ein deutliches Signal, das musste 2 Tage später (beim Stand von ca. 1.700 Unterstützern) auch Weleda-Verwaltungsrat Ueli Hurter einräumen. Allerdings ist mit einer förmlichen Reaktion nicht zu rechnen: Lediglich mündlich wurde mitgeteilt, dieses Votum würde ernst genommen, an den getroffenen Entscheidung zur Reduktion würde dennoch festgehalten. Die Petition sei zu spät gekommen. Ist es wirklich zu spät, von irreversiblen Massnahmen abzusehen? Denn in der Petition wurde vor allem gefordert: «Die Unterzeichner bitten dringend um eine Neuordnung dieser Verhältnisse und um einen Stop der Umwandlung nichtalkoholischer Arzneimittel in die alkoholhaltige Form, bis eine Klärung der Sachlage stattgefunden hat. Weiterhin sollen alle Maßnahmen unterlassen werden, die zum Verlust von Zulassungen führen und eine Wiederaufnahme der industriellen Herstellung verunmöglichen.»
Aktueller Stand: ca. 3.100 Unterzeichnungen (6. Jan. 2023).
Im Laufe der Gespräche über den Verbleib der Weleda-Aktien, wurde seitens des Vorstandes ein Entwurf für eine zukünftig zu verwirklichende Vision zur Eigentümerschaft präsentiert:
«VISION: Zukünftige Eigentümer der Weleda:
Die Weleda AG gehört den Stakeholdern ihrer Produkte
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- den interessierten Kunden
- den Tätigen in der integralen und komplementären Medizinbewegung und
- den sich für die Weleda interessierenden Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung.»
Weitgehend genau zu diesen Gruppen gehören die Unterzeichner der Petition: Es sind nicht nur interessierte, sondern betroffene konkrete Stakeholder im Sinne von Kunden, Patienten, Ärzten, Aktionären, Mitgliedern einer Hauptaktionärin. Inwieweit auch Mitarbeiter unterzeichnet haben, ist nicht erkennbar. Warum macht man mit der angeblichen Vision nicht konkret ernst, auf die Stakeholder zu hören, mit diesen in Kommunikation zu treten …
Woher jedoch stammt diese Stakeholder-Vision? In den mir bekannten anthroposophischen Sozialideen hat sie nicht ihren Ursprung. Sie widerspricht auch dem, was Justus Wittich in Anthroposophie weltweit formulierte («Die Eigentümerschaft einer Firma ist über den von ihr gewählten Verwaltungsrat für die Ausrichtung und Zielsetzung zuständig …»[1]) und kann es wirklich sein, dass die ursprünglichen Intentionen infrage gestellt werden können von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten, die mehrheitlich mit Anthroposophie nichts zu tun haben?
Mit dem von Rudolf Steiner formulierten Assoziationsprinzip kann die Entwicklung der Weleda von einem bedarfs- zu einem marktorientierten Unternehmen auch nicht in Verbindung gebracht werden.
Bemerkenswert: Das Stakeholder-Konzept ist Bestandteil der B-Corp-Zertifizierung[2], woraus sich Verbindungen zur UN-Agenda 2030 ergeben, wo dieses Konzept als «Stakeholder Kapitalismus»[3] auch von Klaus Schwab, dem Gründer und Sprecher des WEF, für den «Great Reset»[4] propagiert wird. Und damit schliesst sich die Verbindung zu der Tatsache, dass sich die Weleda als eine Repräsentantin von «One Health» präsentiert – nicht der Anthroposophie (Siehe Rundbriefe 46 und 49[5]). So ist zu hinterfragen, wie man am Goetheanum auf die Idee kommt, Derartiges zur Vision für die Weleda AG zu erklären? Wie kann dies mit anthroposophisch orientierten assoziativen Gestaltungsideen vereinbart werden?
Thomas Heck
[1] Anthroposophie weltweit 7-8/21.
[2] https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/ und
https://de.wikipedia.org/wiki/B_Corporation_(Zertifikat)
[3] https://www.nzz.ch/feuilleton/der-angeblich-bessere-kapitalismus-eine-kritik-von-klaus-schwab-ld.1595963
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/The_Great_Reset
[5] www.wtg-99.com/Rundbriefarchiv
von Thomas Heck | Dez 16, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Schon seit Jahren wird das Heilmittelsortiment bei der Weleda AG immer weiter reduziert. Diese Heilmittel sind eine unverzichtbare Grundlage der Anthroposophischen Medizin, die in ihrem Bestand dadurch gefährdet wird. Aktuell soll der Bestand nochmals um 1/3 reduziert werden und darüber hinaus wichtige Heilmittel, die als Triturationen (Pulver) verfügbar sind, nur noch als alkoholische Tropfen hergestellt werden. Insgesamt handelt es sich um ca. 220.000 Packungen jährlich, die nicht mehr industriell hergestellt werden sollen und damit nicht mehr oder nur als individuell angefertigte Präparate verfügbar sein werden.
Dieser Text fasst die Forderungen eines offenen Briefes der Ärztin Ilona Metz, Pforzheim, an die Verantwortlichen der Weleda (zum vollständigen Text) zusammen. Um etwas erreichen zu können, ist eine breite Beteiligung erforderlich.
Die Unterzeichner bitten dringend um eine Neuordnung dieser Verhältnisse und um einen Stop der Umwandlung nichtalkoholischer Arzneimittel in die alkoholhaltige Form, bis eine Klärung der Sachlage stattgefunden hat. Weiterhin sollen alle Maßnahmen unterlassen werden, die zum Verlust von Zulassungen führen und eine Wiederaufnahme der industriellen Herstellung verunmöglichen.
Thomas Heck
Die Unterschriftensammlung ist abgeschlossen. Insgesamt haben sich über 4.600 Unterzeichner aus 42 Ländern für den Erhalt der Weleda-Heilmittel ausgesprochen. Trotz dieses deutlichen Votums der betroffenen Menschen – darunter viele Ärzte – haben die Verantwortlichen an ihrer Entscheidung festgehalten.
von Thomas Heck | Dez 7, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
(Direkt zur Unterschrift)
Am Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit vor ca. 35 Jahren konnte man mit Weleda-Medikamenten nahezu die komplette Versorgung der Patienten vornehmen, sowohl in der Klinik als auch in der Praxis, es bedurfte kaum der Ergänzung durch Präparate anderer Herstellfirmen und kaum schulmedizinischer Präparate.
Dann begannen die Streichwellen, und mit jeder Streichwelle entstanden größere Lücken, die nur durch erhebliche Anstrengung und Zeitaufwand ausgeglichen werden konnten und können.
Beispielsweise wurden früh schon wichtige und hochwirksame gynäkologische Mittel herausgenommen, dagegen sind die jetzt noch vorhandenen nur schwach und unzureichend wirksam. Mit der letzten Streichung (ca. 2017/18) nahm man unter vielem anderen die blutstillenden Präparate Tormentilla und Capsella bursa-pastoris weg, eine Katastrophe, weil es dafür auch bei anderen Firmen keinen adäquaten Ersatz gibt; Mischpräparate können Einzelpräparate in der Wirkung nicht ersetzen. Verschwunden ist durch Streichung auch das Präparat Agaricus muscarius D 30, ein hervorragendes Mittel für schwere postgrippale Zustände mit meningealer Reizung.
Viele, viele Male in jener Zeit im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts habe ich versucht, diesbezüglich in echten Gesprächskontakt mit der Weleda zu kommen, ja, wir hatten sogar ein Treffen mit Leitungsmitgliedern erbeten. Aber die (ca. 2009) daran teilnehmenden Weleda-Mitarbeiter erklärten, dass ihnen kein Einflussrecht auf solche Fragen zugestanden wird. Aus welchen wahren Hintergründen und von wem die Streich-Entscheidungen getroffen werden, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Bekannt war lediglich, dass ein – jetzt an entscheidender Stelle stehendes – Mitglied der GAÄD beratend dabei tätig war. Erst später erfuhr ich durch persönliche Begegnung, dass eine kleine Gruppe von Ärzten aus Deutschland und der Schweiz beauftragt waren, die zu streichenden und zu erhaltenden Medikamente zu erarbeiten.
Gleichzeitig konnte man wahrnehmen, wie innerhalb der Weleda eine deutliche Kursänderung stattfand. Unter anderem wurde in den Weleda-Nachrichten von einem Yoga-Kurs für die Mitarbeiter berichtet, und die jetzigen Werbenachrichten, die man regelmäßig als E-mails erhält, liegen auf einem völlig außeranthroposophischen Primitiv-Niveau, so dass man sie schneller wegklickt als man sie angeklickt hat. Der gleiche Niveaumangel gilt auch für die Gestaltung der Geschenkpackungen im Kosmetikbereich.
Zugleich mit der letzten Streichwelle, die angeblich aus Einsparungsgründen stattfand, wurden in mehreren großen europäischen Städten Weleda-Wellness-Zentren (Weleda City Spa) eröffnet. Geld war also ganz offensichtlich vorhanden dafür. Letztere gerieten bald in die Corona-Schließungs-Zeiten und verursachten vermutlich eher erhebliche Kosten anstatt Umsatz-steigerungen zunächst. – Sind das die anderen Geschäftsfelder, in die Weleda investieren bzw. sich ausdehnen will?
Mittlerweile befinden wir uns in der nächsten Streichwelle, die zum Jahresende 2022 vollständig greifen soll. Bei Durchsicht der Streichliste, die ich mir erbeten habe, entdeckte man wieder einige wichtige, unersetzliche, künftig dann fehlende Mittel wie Carbo Betulae D3 für Durchfälle, Phosphor D20 für Herzbeschleunigung und Hamamelis destillata 10%, eine sehr besondere Salbe für einerseits Haemorrhoiden, aber auch als Arnica-Ersatz bei Arnica-Allergikern. Um Fortbestand dieser drei Mittel wird dringend gebeten!!!
Man entdeckte aber etwas noch Gravierenderes: die wortwörtliche Schnaps-Idee der Weleda. Was will das heißen? Es heißt, dass sämtliche Triturationen (Verreibungen, Pulver) außer Handel genommen werden und umgesetzt werden in Tropfenform, einige wenige in Tablettenform. Das mag hilfreich sein bei Laktose-intoleranten Patienten. Aber es heißt, dass man Weleda-Arzneimittel, abgesehen von den Ampullen und einigen wenigen Rh-Dilutionen, vorwiegend nur noch in alkoholischer Darreichungsform erhält, teilweise in nicht gerade geringer Alkoholprozentigkeit. Rudolf Steiner sagt ganz deutlich, dass bei Menschen auf einem geistigen Schulungsweg jeder Tropfen Alkohol sie um Wochen zurückwirft. Und die Kinder, deren Gehirn noch in Entwicklung ist? Die Eltern sind sehr viel bewusster als früher bezüglich der Alkoholwirkung – da werden viele Weleda-Präparate künftig obsolet sein. Gerade für die Menschen, die keine alkoholischen Medikamente möchten, bilden die Triturationen eine so wesentliche Darreichungsform – wobei alternativ natürlich auch Tabletten oder Globuli möglich sind. Dilutionen herzustellen – sofern es nicht Rh-Dilutionen sind, ist natürlich einfacher und zeitsparender als der lange Verreibungs- oder Rührvorgang bei den Triturationen; aber die nahezu völlige Umstellung auf alkoholische Dilutionen entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen der Patienten.
Wieder eine extrem anti-anthroposophische Maßnahme, ganz inakzeptabel, und für den Umsatz der Weleda vermutlich nicht sehr förderlich.
Wer trifft inzwischen bei Weleda die Entscheidungen? Mit welcher Zielsetzung? Es darf so nicht weitergehen! Seltsamerweise sind für abstruse Zertifizierungen außerhalb jeglicher Geisteswissenschaft sowie für Gemeinwohlbespendungen bisher offensichtlich ausreichend Gelder vorhanden gewesen, aber für das, wofür Weleda gegründet wurde: für die Herstellung anthroposophischer Arzneimittel scheinbar nicht mehr.
Es ist mir bzw. den Unterzeichnern bewusst, dass die schwierigen Zeitereignisse auch Konsequenzen erfordern. Und der jüngste Umsatzeinbruch der Weleda zeigt das in besonderem Maße. Aber Weleda hat auch versucht, ein immer weniger anthroposophisch orientiertes Gewinnunternehmen zu werden statt ein Unternehmen, das sich (im Sinne der sozialen Dreigliederung) nach dem Bedarf richtet. Stattdessen wird für Märkte produziert, was nach Rudolf Steiner zur Karzinombildung, zu Kulturkrebs führt (GA 153,1997, S. 174). Und wenn man nicht steht zur eigentlichen Aufgabe und Sache, dann dissoziieren die Verhältnisse und die Sache verliert ihre Kraft und Geltung.
Es ist an der Zeit, dass diejenigen ein Mitsprache- und Bestimmungsrecht erhalten, welche die Dinge aus dem anthroposophisch-medizinischen Bedarf heraus anschauen und lenken können und dass wieder entsprechende Mitarbeiter ausgesucht werden. Es bedarf einiger Klarstellungen im bisherigen Dunkel des Wirtschaftens und ein neues Ergreifen aus geistigen Impulsen.
Der entsprechende Gesichtspunkt gilt auch für die zukünftige Trägerschaft der Goetheanum-Weleda-Aktien, die von Sachkompetenz und nicht nur von Funktionärsebene und Schatzmeisterinteresse bestimmt sein sollte.
Die Unterzeichner bitten dringend um eine Neuordnung dieser Verhältnisse und um einen Stop der Umwandlung nichtalkoholischer Arzneimittel in die alkoholhaltige Form bis eine Klärung der Sachlage mit den Unterzeichnern stattgefunden hat.
Weiterhin sollen alle Maßnahmen unterlassen werden, die zum Verlust von Zulassungen führen und eine Wiederaufnahme der industriellen Herstellung verunmöglichen.
Ilona Metz, Pforzheim, Ärztin für Allgemeinmedizin
Anfügung: Nach Fertigstellung des Briefes erreichten mich die Bitten von Kollegen, folgende Präparate dringend zu erhalten:
- Gencydo 0,1% Ampullen, da 1%ige nicht jedem Allergiker-Patienten zuzumuten sind. nicht für jeden Allergiker-Patienten geeignet sind.
- Ferrum rosatum/Graphites, Tropfen für Kinder mit ständigen Infekten.
- Bryonia D6 Ampullen – ein wichtigstes Pneumonie- und Bronchitis-Mittel, für Kinder auch zur Inhalation geeignet. Diese sind bei keiner anderen Herstellfirma mehr erhältlich.
Die Unterschriftensammlung ist abgeschlossen. Insgesamt haben sich über 4.600 Unterzeichner aus 42 Ländern für den Erhalt der Weleda-Heilmittel ausgesprochen. Trotz dieses deutlichen Votums der betroffenen Menschen – darunter viele Ärzte – haben die Verantwortlichen an ihrer Entscheidung festgehalten.
(Direkt weiter zur Unterschrift)
(Zur vollständigen Liste der Unterzeichner)
Weitere Unterzeichner:
Dr. med. Wolfgang Leonhardt, Zwietow/Dresden, Arzt für Allgemeinmedizin
Dr. med. Christoph Stolzenburg, Marbach/Neckar, Kinderarzt
Karsten Rentsch, Esslingen, Arzt für Allgemeinmedizin
Wolfdieter Schlicksupp, Engelsbrand, Arzt für Allgemeinmedizin
Maria Becker, Unterlengenhardt, Ärztin für Allgemeinmedizin
Anni Kirchner, Pforzheim, Ärztin für Psychiatrie/Neurologie
Dr. med. Herta Messer, Heidelberg, Kinderärztin
Dr. med. Gabriele Gottschalk-Aschenbrenner, Heidelberg, Ärztin für Allgemeinmedizin
Dr. med. Mona Ruef, Heidelberg, Waldorfschulärztin
Annette Bogatay, Wieslet, Ärztin für Allgemeinmedizin
Brigitte Bell, Neustadt/Weinstrasse, Ärztin für Allgemeinmedizin
Christiane Fiedler, Marbach/Neckar, Kinderärztin
Franziska Schlicksupp, Schömberg, Ärztin für Innere Medizin
Dr.med. Michaela Heisenberg, Kreuzlingen, CH
Dr.med. Helena Heisenberg, Kreuzlingen, CH
Eva Lohmann-Heck, Dornach
Thomas Heck, Dornach
Angelika Kabus, Worms
Iris Graßer, Osthofen
Angela Münich, Ladenburg
Tobias Strohbach, Heidelberg
Herbert Heinz, Unterlengenhardt
Georg Dörhage, Wieslet
Ulrike Ludwig, Pforzheim
Herbert Ludwig, Pforzheim
Gabriele Lange, Unterlengenhardt
Udo Lange, Unterlengenhardt
Marina Wassner, Schifferstadt
Joseph Wassner, Schifferstadt
Anette Lückert, Neustadt/Weinstrasse
Annabella Brenken, Solothurn
Gudrun Aichele, Mühlacker
Anita Becht, Birkenfeld
Theresia Wiesinger, Mühlacker
Rolf Leipp, Mühlacker
Beatrice Eberlein-Svensson, Niedergladbach
Lars Svensson, Niedergladbach
Jorun Svensson, Berlin
(Zur vollständigen Liste der Unterzeichner)
von Thomas Heck | Dez 7, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Das Mitgliederforum zu der angeblichen «Kontroverse» um «One Health» am 21. November 2022 am Goetheanum brachte auf den Punkt, was schon durch die Veröffentlichungen in «Das Goetheanum», Nr. 44/22 deutlich geworden war: trotz massiver Bedenken und Kritik hält man am Goetheanum, insbesondere in der medizinischen und der landwirtschaftlichen Sektion, an dem eingeschlagenen Kurs fest: Dieser von der Goetheanum-Leitung beschlossene Weg soll unbeirrt und fest entschlossen weitergegangen werden: Durch eine Kooperation mit ausgesuchten und allgemein (vom Mainstream) anerkannten internationalen Institutionen, soll die Anthroposophie vor Angriffen aus der Politik und von Medien geschützt werden![1]
Bei einer Kontroverse handelt es sich um einen anhaltenden Streit, einen Disput oder eine Debatte.[2] Damit ist also eine Erkenntnisauseinandersetzung gemeint. Da eine solche aber gar nicht stattfindet, sondern längst Tatsachen geschaffen wurden (die Zusammenarbeit mit der WHO und «One Health» ist bereits weit fortgeschritten), kann in dieser Fragestellung (wie in vielen anderen auch), von einer echten Kontroverse gar keine Rede sein. Sehr wohl aber sind Ansichten entstanden, die sehr kontrovers sind. Tatsächlich ist durch einseitiges Handeln bereits ein Konflikt entstanden, der nach dem Phasenmodell von Konflikten (nach Friedrich Glasl) mindestens auf Stufe 3 anzusiedeln ist, insoweit dieKritiker unsachlich diskreditiert werden, auch höher.[3] Dass seitens der Leitung eine ‹Kontroverse› imeigentlichen Sinne einer Erkenntnisauseinandersetzung mit der Mitgliedschaft nicht gewollt wird, kam an diesem Abend sehr deutlich zum Ausdruck.
Das Interesse an dem Mitgliederforum war erwartungsgemäss gross, ca. 130 Menschen waren gekommen: Von der der Goetheanum-Leitung waren Matthias Girke, Ueli Hurter, Justus Wittich, Georg Soldner und die zukünftige Co-Leiterin der Medizinischen Sektion, Marion Debus, anwesend.
Im Kern ging es um die unterschiedlichen Einschätzungen der moralischen, ethischen, politischen und okkulten Hintergründe und Ziele dieser Organisationen bzw. Bewegungen (insbesondere die mit «One Health» verbundenen Organisationen wie die WHO), deren Lauterkeit nicht nur in unseren Kreisen stark in Frage gestellt wird: Sind es ehrlich am Menschheitswohl orientierte Ziele, die verfolgt werden oder stehen doch im Hintergrund die politischen und okkulten Weltbeherrschungsabsichten derjenigen Kreise, auf die Rudolf Steiner immer wieder hingewiesen hat und deren Absichten auch exoterisch bekannt sind, da diese konkret geäussert wurden? Darauf wurde bereits im Vorfeld mehrfach hingewiesen.1 Auch wenn diese Aspekte nur am Rande ausgesprochen wurden, waren sie letztlich in der Debatte massgeblich.
Der Abend war geprägt von Rechtfertigung und Verteidigung des vom Goetheanum eingeschlagenen Weges. In seinem Eingangsstatement versuchte Georg Soldner den Begriff «One Health» von dem Zusammenhang mit der WHO zu lösen: es handele sich dabei um einen allgemeinen Begriff aus der Wissenschaftswelt, unter dem das Thema Gesundheit weltweit in den verschiedenen Disziplinen diskutiert würde. Man konnte den Eindruck gewinnen, als habe die WHO mit «One Health» gar nichts zu tun. Das allerdings konnte nicht überzeugen (eine einfache Recherche im Internet bringt mehr oder weniger unmittelbar den Zusammenhang von «One Health» mit den internationalen Organisationen zum Vorschein, insbesondere mit der WHO) und es wurden dieser Aussage entsprechende Zitate entgegengestellt. Auch der Versuch, die WHO aus ihren fragwürdigen Zusammenhängen, den wirklich im Hintergrund stehenden Absichten und Zielen, zu einer rein internationalen, wissenschaftlichen Plattform ‹weisszuwaschen›, konnte nicht überzeugen, denn auch diese Behauptungen konnten einschlägig widerlegt werden: durch eine Verlautbarung der WHO, aus der sowohl die enge Verbindung zu «One Health» als auch die politischen Ziele bis hin zur Kontrolle der Bevölkerung eindeutig hervorgehen.[4] Aber noch schlimmer als die WHO seien in der Pandemie die Nationalstaaten gewesen, die die von der WHO (offiziell) empfohlenen Maßnahmen noch verstärkt hätten, so Georg Soldner. Es war zwar das Eingeständnis, dass die WHO doch auch eine problematische Seite habe, noch schlimmer aber seien die Nationalstaaten.
Nicht zu erkennen war, dass er sich auf die geäusserten Bedenken einlassen konnte. Hinzu kam, dass er denjenigen, die in der Übertragung nationaler Souveränitätsrechte an supranationale Organisationen (wie zum Beispiel der WHO) und in der Zusammenarbeit mit diesen ein Problem sehen, vorwarf, sie würden grundsätzlich internationale Zusammenarbeit ablehnen. Und sie würden für den nationalen Einheitsstaates plädieren. Vorwürfe ohne jede Grundlage.
Wie tief die entstandenen Gräben inzwischen geworden sind, kam in folgender Aussage zum Ausdruck: Georg Soldner sah für eine sachliche Diskussion dieser Fragen keine gemeinsame, wissenschaftliche Basis. Bei dem, was von den Kritikern vorgebracht wurde, handle es sich lediglich um Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hätten.
Leiden denn alle, die hier Bedenken haben und diese auch begründen können, unter Realitätsverlust? In diesem Fall wäre in der Tat jede Diskussion aussichtslos. Insofern war Georg Soldners klare Reaktion auf die Frage, ob eine derartig schwerwiegende Entscheidung (die Kooperation mit diesen internationalen Institutionen) mit der Mitgliedschaft nicht hätte vorgängig besprochen werden müssten, konsequent: Nein, das sei nicht der Fall: Entscheidungen über die Ausrichtung der Medizinischen Sektion lägen im Bereich des freien Geisteslebens und eine Besprechung, oder gar eine Abstimmung mit der Mitgliedschaft, käme gar nicht infrage. Ein aristokratisches Verständnis von freiem Geistesleben! So reklamiert Georg Soldner für sich als Sektionsleiter freies Geistesleben – um dieses Andersdenkenden absprechen zu können.
Er stand ziemlich allein da, seitens der Anwesenden unterstützte ihn hierin niemand. Auch die ärztlichen Kollegen, die das Wort ergriffen hatten, widersprachen dem ungebremsten Vorgehen vehement. Nur Ueli Hurter äusserte sich bezüglich «One Health» positiv. Er stellte seinem Beitrag voran, dass dieser naiv klingen könnte und beschrieb dann, wie er für sein Erleben der Ganzheit eines biologisch-dynamischen Hoforganismus in den Worten «One Health» einen stimmigen Ausdruck gefunden habe.
Matthias Girke, Justus Wittich und die zukünftige Sektionsleiterin, Marion Debus, schwiegen – oder kamen nicht zu Wort?
Man mag es positiv ansehen, dass der Abend gesittet verlief, dass die sicher vorhandenen emotionalen Reaktionen unter der jeweils persönlichen Kontrolle blieben. Eine Annäherung, oder auch nur ein wenigstens anfängliches Verständnis für die vorgebrachten Bedenken, war nicht zu erkennen.
Wie allerdings die offenbaren Gräben überwunden werden können, wenn alle Argumentation abprallen, als gar nicht auf Tatsachen gegründet abqualifiziert werden und den Kritikern Aussagen unterstellt werden, die sie gar nicht getätigt haben, ist nicht erkennbar. Erkennbar war allerdings, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden soll, unbeirrt und fest entschlossen!
Thomas Heck
[1] Diese und weitere Aussagen beziehen sich inhaltlich auf Beiträge aus «Was in unserer Gesellschaft noch vorgeht», u.a. Ausgaben 44, 46 und 47. www.wtg-99.com, Rundbrief-Archiv.
[2] Siehe Wikipedia.
[3] Vielfach im Internet zu finden, z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenmodell_der_Eskalation.
[4] https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health und weiter ausführlich:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240059139. Weitere Hinweise in den in Fussnote 1 genannten Publikationen.
von Thomas Heck | Okt 14, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, Zeitgeschehen
Das Ende des ethischen Individualismus?
Unübersehbar ist die Entwicklung zu immer mehr überstaatlich agierenden Institutionen, denen zunehmend Aufgaben übertragen werden, die eigentlich in den Bereich der Souveränität selbständiger Staaten gehören. Begründet wird diese Entwicklung damit, dass die vielfältig bestehenden humanen, sozialen und ökologischen Probleme nur auf globaler Basis gelöst werden könnten. So ist im Laufe der Jahrzehnte ein riesiges, undurchsichtiges und unübersehbares globales Netzwerk von Organisationen, Instituten, Stiftungen, Think Tanks (Übersetzung von Tanks = Panzer!), NGOs uvm. entstanden, welche immer mehr Einfluss nehmen auf das Weltgeschehen – ohne demokratische Legitimation und Kontrolle. Diese Netzwerke bilden eine perfekte Grundlage für eine neue Weltordnung, eine Weltregierung. Dass eine solche Entwicklung angestrebt wird, ist inzwischen nicht nur offensichtlich, sondern auch vielfach geäussert worden («New Worldorder und Weltregierung», Seite 4). Als Verschwörungstheorie kann dies nun wirklich nicht mehr diskreditiert werden. Die bekanntesten Institutionen in diesem Zusammenhang sind wohl die EU, die WHO, der Internationale Währungsfond, die Weltbank, die UNO mit ihren zahlreichen Ablegern, die NATO und viele mehr. So befinden wir uns heute weltweit in einem Prozess, an dessen Ende auch die scheindemokratischen Verhältnisse abgeschafft sein werden und an deren Stelle die Aristokratisierung treten wird, von der Rudolf Steiner bereits 1905 sprach, wie bereits in Rundbrief 43 ausgeführt wurde. Auch er wies darauf hin, dass eine Weltherrschaft angestrebt würde.[1]
«Europa soll so eingerichtet werden, dass die kommerziell-universale Monarchie begründet werden kann. Diese Einteilung von Europa, welche sich da ergibt, ist wohl dazu geeignet, die kommerzielle Weltherrschaft zu begründen. Zur Begründung der kommerziellen Weltherrschaft ist es nicht nötig, auch immer gleich die Territorien unmittelbar anzustreben. Will man nämlich eine kommerziell-industrielle Weltherrschaft begründen, so muss man das Hauptgebiet, auf das es ankommt, zunächst in zwei Teile teilen. Wir haben es also zu tun mit einer Zweispaltung der Welt, und es handelt sich darum, dass diese Zweispaltung der Welt so durchgeführt werde, dass man der Welt sagen kann: Wir wollen den Frieden haben und sind nur für den Frieden.»[2]
Zu diesem Netzwerk gehört auch «One Health», ein «ganzheitliches» Konzept, um die Gesundheit von Mensch, Tier und Ökosystem global und nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen. Der Zusammenhang mit diesem Netzwerk wird offensichtlich, wenn man sich vergegenwärtigt, von welchen Organisationen dieses Konzept getragen wird (siehe «One Health, Seite 4»). An vorderster Stelle steht die Weltgesundheitsorganisation und es sei nur am Rande darauf hingewiesen, dass diese beteiligten Organisationen auf der Spendenliste der Bill und Melinda Gates Foundation (BMGF) mehrfach zu finden sind.[3]
Der Grundgedanke, die Gesundheit von Mensch, Tier und Ökosystem gleichzusetzen, mag vordergründig plausibel klingen, ist jedoch aus anthroposophischer Sicht ein fragwürdiger Ansatz, denn Gesundheit und Krankheit haben für die individuelle Entwicklung des Menschen eine gänzlich andere Bedeutung als Gesundheit für Tier, Pflanze und Umwelt. Diese Gleichsetzung in dem «One Health»-Konzept entspricht durchaus den Zielen, die mit dem durch das World Economic Forum (WEF) propagierten «Great Reset» verfolgt werden. Demnach wird sich der Einzelne dem zu unterwerfen haben, was nach allgemein geltender materialistisch orientierter Naturwissenschaft allgemein für das Vernünftige und Richtige angesehen werden wird. So werden offensichtlich von diesen Organisationen Verhältnisse angestrebt, die der 3. nachatlantischen Kulturepoche entsprechen:
«Die Menschheit strebt im Anfang der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen.»[4]
Die aktuellen Bestrebungen dieser übernationalen Organisationen laufen auf eine Renaissance des Kant’schen Imperativs hinaus: «Handle so, dass die Grundsätze deines Handelns für alle Menschen gelten können.» Die Konsequenz daraus: «Dieser Satz ist der Tod aller individuellen Antriebe des Handelns. Nicht wie alle Menschen handeln würden, kann für mich maßgebend sein, sondern was für mich in dem individuellen Falle zu tun ist.»[5]
Zum Schutz der Anthroposophie?
Zum Schutz vor Angriffen gegen die Anthroposophie werden seitens der Leitenden unserer Institutionen zunehmend Bezüge und Allianzen zu nicht-anthroposophischen Bewegungen propagiert, gesucht und eingegangen. Dies wurde u.a. an der diesjährigen Generalversammlung mehrfach zum Ausdruck gebracht.
«Bei den exemplarischen Darstellungen aus der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft sprach Peter Selg über die Arbeit der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion. Dabei empfahl er mit Bezug auf Martin Buber, Anthroposophie mit ihr nahestehenden Strömungen und Persönlichkeiten zu verbinden. Das würde sie schützen, denn den jüdischen Philosophen beispielsweise würde man nicht ins Visier nehmen.»[6]
«Es wird so sein, dass dieses Jahr Weleda und Wala viel von ihren Fertigarzneimitteln streichen müssen; wir erleben schmerzhafte Verluste, wir erleben eine grosse Krise, wir erleben aber auch neues Interesse und wachsende Begeisterung für die Möglichkeiten, die unsere Medizin bietet im Einklang mit einer neuen Bewegung für ‹planetarische Gesundheit› und ‹One Health› […].» Georg Soldner an der GV 2022.[7]
Über die Spenden in Höhe von 3 x 65.000 $ an die WHO für die gemeinsame Entwicklung von Ausbildungsstandards wurde bereits berichtet.[8] Aber auch weitergehende Absichten bestehen bzw. haben zumindest bestanden:
«WHO-Anerkennung angestrebt
Vertreter der World Health Organisation (WHO) haben sich Ende letzten Jahres [2018] im Berliner Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe zu einer dreitägigen Konferenz getroffen. Dabei ging es um das Anerkennungsverfahren der Anthroposophischen Medizin als Integratives Medizinsystem der WHO. Dieses Jahr soll daran gearbeitet werden. die verschiedenen anthroposophischen Ausbildungscurricula mit den WHO-Anforderungen weiter abzugleichen. Angestrebt wird, möglichst im Jahr 2020 die WHO-Anerkennung der Anthroposophischen Medizin als Integratives Medizinsystem zu erlangen.»[9]
Anstatt der Anthroposophie bzw. der Anthroposophischen Medizin wurde in dem Geschäftsbericht 2021 der Weleda «One Health» in den Mittelpunkt gestellt – neben der B Corp Zertifizierung mit ähnlichem Hintergrund. (Siehe Abbildung Seite 1. Ausführlicher wird auf den Geschäftsbericht in einer nächsten Ausgabe eingegangen werden.)
Letztlich muss die Frage erlaubt sein, ob die erkennbaren Strategien zum Schutz der Anthroposophie und der anthroposophischen Institutionen sinnvoll und wahrhaftig sind, ganz abgesehen davon, ob dieses Vorgehen überhaupt von der Mitgliedschaft wirklich mitgetragen wird. Aber kann denn überhaupt so ein wirksamer Schutz erreicht werden? Wird nicht die anthroposophische Substanz verleugnet, wenn man sich mit Bewegungen verbindet, denen die Paradigmen einer materialistisch gesinnten Naturwissenschaft zugrunde liegen? Ist dieses Vorgehen vergleichbar mit dem, was Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung als «verlogen» bezeichnet hatte?[10]
«Man muss den Leuten zuerst die Praxis der Heilmittel zeigen, man muss ihnen zeigen, dass das richtige Heilmittel sind, dann werden die Leute das kaufen. Dann werden sie später einmal erfahren, da stecke die Anthroposophie dahinter, und dann werden Sie auch da an die Anthroposophie herankommen. – Wir müssen den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden. Erst wenn wir den Mut haben, solch ein Vorgehen verlogen zu finden, es innerlich verabscheuen, dann wird Anthroposophie ihren Weg durch die Welt finden. Und in dieser Beziehung wird schon gerade das Wahrheitsstreben dasjenige sein, was in der Zukunft von Dornach hier ohne Fanatismus, sondern in ehrlicher, gerader Wahrheitsliebe verfochten werden soll.»
Darüber mag jeder selber urteilen.
Auf Seite 4 finden Sie Ausführungen zu den Hintergründen von «One Health» von Kirsten Juel und Roland Tüscher, den Herausgebern der Zeitschrift «KERNPUNKTE», in der dieser Artikel zuerst erschienen ist (Ausgabe 7/2022).[11] Für weitere Informationen sei auf die Ausführungen verwiesen, die auf der Internetseite von Lorenzo Ravagli erschienen sind: «One Health – eine totalitäre Vision»[12], «Wem dient One Health»[13] und «One Health als trojanisches Pferd»[14]
Thomas Heck
Den vollständigen Rundbrief können Sie hier herunterladen: Link
[1] Z. B. in GA 181, 9. April 1918, GA 174b, 21. März 1921, GA 174, 15. Jan. und 22. Jan. 1917.
[2] GA 174, 1983, S. 162.
[3] https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
[4] GA 31, 1989, S.255.
[5] GA 4, 1995, S. 159.
[6] «Anthroposophie weltweit» 5/22, Bericht von der Generalversammlung von Wolfgang Held.
[7] Zitiert nach «Ein Nachrichtenblatt», 14/2022.
[8] «Ein Nachrichtenblatt», 14/2022 und «Merkurstab» 1/2022.
[9] «Anthrosana», Ausgabe Frühling 2019.
[10] GA 260, 1994, S. 279.
[11] Internetseite: www.kernpunkte.com
[12] https://anthroblog.anthroweb.info/2022/one-health-eine-totalitaere-vision/
[13] https://anthroblog.anthroweb.info/2022/wem-dient-one-health/
[14] https://anthroblog.anthroweb.info/2022/one-health-als-trojanisches-pferd/
von Thomas Heck | Sep 7, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Die Mitgliedschaft war seit 1925 über viele Jahrzehnte davon überzeugt, es handle sich bei der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft um die von Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung 1923/24 gegründete Gesellschaft. Dieser Annahme lagen Irrtümer über das damalige Geschehen zugrunde, die jetzt auch offiziell als solche anerkannt sind und deren Aufarbeitung begonnen hat. Denn tatsächlich handelt es sich bei der AAG um den am 8. Febr. 1925 umbenannten „Verein des Goetheanum Freie Hochschule für Geisteswissenschaft“, der bereits 1913 zur Vermögensverwaltung und nicht als Mitgliedergesellschaft gegründet wurde.
(Der gesamte Text inkl. einer Herleitung aus der aktuellen Statutenversion und entsprechenden Kommentierungen kann hier als PDF-Dokument heruntergeladen werden.)
Weiterlesen
von Thomas Heck | Sep 2, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
«Die Anthroposophische Gesellschaft muss Menschen vereinigen, die sich heute als den Kern von dem fühlen, was immer weitere und weitere Kreise ziehen muss in der Zivilisation der Menschheit, damit die Fortschrittsentwickelung der Menschheit wirklich geschehen könne und das Erdenleben nicht verfalle.» Rudolf Steiner, 2. Mai 1923
Angesichts der weltweit bestehenden Probleme und Krisen, wie z.B.
- Umwelt und Klima
- Terrorismus
- Sicherheit und Verteidigung
- Wirtschafts- und
- Digitalisierung
- Weltfinanzen
- Gesundheit
wird immer und immer wieder mantrenartig wiederholt, dass diese Probleme nur international bzw. global gelöst werden können. Die Folge: Eine immer weiter sich ausdehnende Aushöhlung der bereits fragwürdigen repräsentativen Demokratie, indem nationale Souveränitätsrechte an supranationale Institutionen und Organisationen übertragen werden. Diese sind in aller Regel demokratisch nicht legitimiert, sondern werden von kleinen – zum Teil unbekannten – Eliten bzw. Oligarchen beherrscht, die den pharmazeutisch-militärisch-finanziell-digitalen Komplex bilden. So tritt immer weiter zunehmend an die Stelle einer zeitnotwendigen Demokratisierung und Liberalisierung eine Aristokratisierung der politischen Weltverhältnisse, der sich die nationalen Verhältnisse unterzuordnen haben – eine brutale Aristokratisierung,[1] wie von Rudolf Steiner bereits 1905 vorhergesagt wurde.
Was wir heute erleben ist nichts anderes, als das, was er 1917 mit Bezug auf den ersten Weltkrieg beschrieben hatte:[2]
«Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit den Mitteln der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen gehören alle diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande ist, durch Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren. Das Wesentliche ist, dass diese Gruppe weiß, in dem Bereich des russischen Territoriums liegt eine im Sinne der Zukunft unorganisierte Menschenansammlung, die den Keim einer sozialistischen Organisation in sich trägt. Diesen sozialistischen Keimimpuls unter den Machtbereich der antisozialen Gruppe zu bringen, ist das wohlberechnete Ziel. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn von Mitteleuropa mit Verständnis eine Vereinigung gesucht wird mit dem östlichen Keimimpuls. Nur weil jene Gruppe innerhalb der angloamerikanischen Welt zu finden ist, ist als untergeordnetes Moment die jetzige Mächtekonstellation entstanden, welche alle wirklichen Gegensätze und Interessen verdeckt. Sie verdeckt vor allem die wahre Tatsache, dass um den russischen Kulturkeim zwischen den angloamerikanischen Plutokraten und dem mitteleuropäischen Volke gekämpft wird. In dem Augenblicke, in dem von Mitteleuropa diese Tatsache der Welt enthüllt wird, wird eine unwahre Konstellation durch eine wahre ersetzt. Der Krieg wird deshalb solange in irgendeiner Form dauern, bis Deutschtum und Slawentum sich zu dem gemeinsamen Ziel der Menschenbefreiung vom Joche des Westens zusammengefunden haben.
Es gibt nur die Alternative: Entweder man entlarvt die Lügen, mit der der Westen arbeiten muss, wenn er reüssieren will, man sagt: Die Macher der angloamerikanischen Sache sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen hat, die vor der Französischen Revolution liegen und in der Realisierung einer Weltherrschaft mit Kapitalistenmitteln besteht, die sich nur der Revolutionsimpulse als Phrase bedient, um sich dahinter zu verstecken – oder man tritt an eine okkulte Gruppe innerhalb der angloamerikanischen Welt die Weltherrschaft ab, bis aus dem geknechteten deutschslawischen Gebiet durch zukünftige Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird.»
An dieser globalen Zentralisierung, die immer weiter betrieben wird und letztlich insbesondere durch die Digitalisierung und die transhumanistischen Bestrebungen in eine Vertierung und Versklavung der Menschheit führen wird, kann und wird sich nur dann etwas ändern, wenn aufgrund von Initiativen aus der Bevölkerung heraus dieser Entwicklung Einhalt geboten und damit die Verantwortung für das eigene und das gemeinsame Schicksal (und das der Menschheitsentwicklung?) übernommen wird.
Auf keinem anderen Wege!
«Denn herrschen muss in der Zukunft nicht eine Regierung, sondern die ganze breite Masse des Volkes. Die Regierung muss regieren und lernen, wie man regiert, wenn tatsächlich die ganze breite Masse des Volkes herrscht.»[3]
«Dass Demokratie restlos das Völkerleben durchdringen muss, sollte eine selbstverständliche Erkenntnis für alle sein, die einen offenen Sinn für das geschichtlich Gewordene haben.»[4]
Diese Notwendigkeit ist jedoch keineswegs mit den heute existierenden einheitsstaatlichen Formen erfüllt, denn die «repräsentative Demokratie» wurde in Wirklichkeit als Mittel «zur Verhinderung von Demokratie» eingeführt.[5] Dies steht nicht im Widerspruch zu der Aussage, dass die Verwirklichung der Dreigliederung eine michaelische Notwendigkeit ist:
«Der alte Einheitsstaat [ist] als solcher, ganz gleichgültig welche Verfassung, welche Struktur er hat, ob er Demokratie oder Republik oder Monarchie oder irgendetwas ist, wenn er Einheitsstaat ist, wenn er nicht dreigeteilt ist, der Weg ist zur ahrimanischen Inkarnation.»[6]
Was hat das mit unseren Gesellschaftsverhältnissen zu tun?
Sehr viel, wie schon aus den zuvor genannten Zitaten hervorgeht:
Wem, wenn nicht einer organisierten Anthroposophenschaft, käme die Aufgabe zu, dass z.B. gerade jetzt «von Mitteleuropa mit Verständnis eine Vereinigung gesucht wird mit dem östlichen Keimimpuls?» Damit «diese Tatsache der Welt enthüllt» und damit «eine unwahre Konstellation durch eine wahre ersetzt» wird und nicht «der Krieg solange in irgendeiner Form» fortgesetzt werden muss, «bis aus dem geknechteten deutschslawischen Gebiet durch zukünftige Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird?»
Aber bleiben wir zunächst bei unseren eigenen Verhältnissen:
Können wir ernsthaft erwarten, dass Anthroposophie zivilisatorisch wirklich heilend wirksam werden und sich in der Welt etwas zum Positiven wenden kann, solange wir selber nicht in der Lage sind, in unseren eigenen Verhältnissen angemessene und zeitgemässe soziale Gestaltungen zu verwirklichen? Müssen wir dies nicht zumindest ernsthaft versuchen?
Und kann man ernsthaft erwarten, dass sich Menschen von den Möglichkeiten der Dreigliederung überzeugen lassen, solange in der Organisation, die – ob es einem gefällt oder nicht – die Anthroposophie in der Welt repräsentiert, einheitsstaatsähnliche Verhältnisse herrschen? Ein freies Geistesleben nicht ermöglicht wird? Das Geschehen in der Gesellschaft von einer kleinen, nicht durch die Mitgliedschaft legitimierten Gruppe beherrscht wird? Und dies auch noch von der Mitgliedschaft akzeptiert wird?
So finden wir eben mit Blick auf die entstehenden totalitären Machtverhältnisse in unseren Gesellschaftsverhältnissen Parallelen, die auch als ‹Vorbild› für das aktuelle Weltgeschehen betrachten werden können. Aktuell ist deutlich: Wir haben eine Gesellschaftsleitung, die sich in ihrem aristokratischen Führungsanspruch auf Rudolf Steiner beruft (Initiativ-Vorstand, Kooption …). Diese, seit Jahrzehnten bestehende aristokratische Führung wurde durch die Einrichtung der Goetheanum-Leitung 2012 weiter manifestiert, welche von der Mitgliedschaft nicht legitimiert und dieser gegenüber nicht rechenschaftspflichtig ist. Es war der Wunsch der Gesellschafts-Leitung, mit der Konferenz der Landesrepräsentanten ein weiteres solches Organ zu etablieren: Ein ebenfalls nicht durch die Mitgliedschaft legitimiertes Organ mit unklaren Aufgaben und Befugnissen und ohne Rechenschaftspflicht. Diesem Ansinnen wurde an der Generalversammlung 2022 von der anwesenden Mitgliedschaft eine klare Absage erteilt.
Wir sollten die Art und Weise, wie wir unsere sozialen Verhältnisse regeln und was in unserer Gesellschaft geschieht in ihrer Wirkung auf das Weltgeschehen nicht zu gering schätzen. Selbstverständlich ist diese Wirkung nicht auf einer rein äußeren Ebene zu suchen. Rudolf Steiner wies 1923 darauf hin, dass die Anthroposophische Gesellschaft eine Art Vortrupp dessen sein solle, «was einfach aus der Notwendigkeit der Zeitverhältnisse heraus immer weitere Ausbreitung gewinnen muss.» Angesichts der allgemeinen Tendenz, Grundrechte abzubauen und Souveränitätsrechte an supranationale, nicht demokratische Organisationen zu übertragen, wäre es eine falsche Geste gewesen, in ähnlicher Weise in unserer Gesellschaft ein weiteres Leitungsorgane zu bilden, wie es von der Gesellschafts-Leitung an der Generalversammlung 2022 gewünscht wurde. Wirklich Not-wendende Veränderungen der heutigen menschen- und freiheitsverachtenden Bestrebungen werden und können nur von der Basis, von einzelnen Individualitäten ausgehen, welche sich in zeitgemässen Formen zu gemeinsamen Initiativen vereinen. Dies gilt gewiss im Besonderen für die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, denn unsere eigenen Verhältnisse können keinesfalls als vorbildlich gelten.
«… das Wichtigste für die Zukunft wird geschehen durch die Tüchtigkeit des einzelnen menschlichen Individuums.»[7]
Auch wenn hier zunächst die inneren Angelegenheiten in unserer Gesellschaft angesprochen werden, wird nicht übersehen, dass gerade aus den Leitungs-Kreisen seit Jahren eine Entwicklungsrichtung verfolgt wird, die nicht anders als eine Anpassung an den ‹Mainstream› bezeichnet werden kann. Darauf wird noch zurückzukommen sein.
Angesichts unserer gesamten Verhältnisse scheint es gerade jetzt, 3 x 33 Jahre nach der Weihnachtstagung, dringend notwendig – und eben auch an der Zeit – aus der Mitgliedschaft heraus Verantwortung und Initiative zu ergreifen, für unsere Gesellschaft, für ein gemeinsames Aufgabenbewusstsein, für die zivilisatorische Aufgabe der Anthroposophie. Aus solcher Initiative sollte sich ein Mitgliederorgan bilden können, als Partner der Leitung auf Augenhöhe und es könnte möglich werden, die entstandenen Gegensätzlichkeiten aufzulösen. Damit würde auch denjenigen eine Teilnahme am Gesellschaftsgeschehen möglich werden, die sich heute nicht repräsentiert fühlen können. Es könnte real werden, was 2011 aus rein taktischen Gründen von Paul Mackay und Bodo von Plato versprochen wurde, aber gar nicht beabsichtigt war: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht.»[8]
Eine solche Initiative benötigt zur Bildung einerseits genügend Rückhalt in der Mitgliedschaft, andererseits ist ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben und der Probleme in der Gesellschaft Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung.
Die Anthroposophische Gesellschaft befand sich 1923 in einer existenziellen Krise, sie stand vor dem endgültigen Zerfall. Rudolf Steiner versuchte die Mitglieder durch einen Rückblick auf die Entwicklung zu einer Selbstbesinnung und zur Selbsterkenntnis auf gesellschaftlicher Ebene zu führen – als Voraussetzung, damit eine Konsolidierung bzw. ein Neugriff hätte möglich werden können.
«Und das ist es, um was ich ja in erster Linie immer wieder und wiederum jetzt unsere Freunde bitte, weil wir dringend vor der Notwendigkeit heute stehen: die Gesellschaft zu einem aktiven, in der Welt wirkenden Wesen zu machen. Das brauchen wir, meine lieben Freunde. Es wäre natürlich höchst wünschenswert, dass das Zentrum in Dornach nicht verfiele, sondern dass sich Freunde fänden, die da Hilfe leisten.»[9]
Wie damals, 1923, ist es auch heute notwendig, in aufrichtiger und vorurteilsfreier Ehrlichkeit die Gesellschaftsproblem zu benennen und aufzuarbeiten, «so dass gerade nach dieser Richtung nicht immer bloß über die Dinge hinweggeredet wird, sondern dass durch Einsicht in die Fehler, durch eine scharfe Beurteilung der Fehler erkannt werde, was in der Zukunft getan werden muss»,[10] denn nur auf «der konkreteren Erkenntnis desjenigen, was mangelhaft ist, [könne] zu einer Gestaltung des Positiven geschritten» werden, so Rudolf Steiner 1923.[11]
Zur Bewältigung der aktuellen Krise – 3 x 33 Jahre nach 1923 – bedarf es ebenfalls eines gemeinsamen Bewusstseins über die Entwicklungen, die Geschichte und die Aufgabe unserer Gesellschaft, insbesondere auch über die problematischen Aspekte.
Mit dem Vortrags- und Gesprächsangebot (siehe Anzeige) soll ein Beitrag zur Entwicklung zukünftiger Gestaltungen geleistet werden, um Bilder und Perspektiven für eine zeitgemässe soziale Gestaltung unserer Gesellschaftsverhältnisse zu entwickeln, Initiative zu ergreifen und zu fördern. Heute, so unsere Überzeugung, kann die hier nochmals zitierte Aufgabenstellung nur dann erfüllt werden, wenn sie initiativ aus der Mitgliedschaft heraus ergriffen und ermöglicht wird:
«Die Anthroposophische Gesellschaft muss Menschen vereinigen, die sich heute als den Kern von dem fühlen, was immer weitere und weitere Kreise ziehen muss in der Zivilisation der Menschheit, damit die Fortschrittsentwickelung der Menschheit wirklich geschehen könne und das Erdenleben nicht verfalle.»[12]
Auf anderem Wege kann kein Gegengewicht geschaffen werden gegenüber den zahlreichen Organisationen und Vereinigungen, die den Widersacherimpulsen dienen. Auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Gemeinschaftsbildung wies Rudolf Steiner bereits 1905 hin:
«Vereinigung bedeutet die Möglichkeit, dass ein höheres Wesen durch die vereinigten Glieder sich ausdrückt. … So sind die menschlichen Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten, in welche sich höhere geistige Wesenheiten herniedersenken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die Glieder des Körpers wirkt. … Zauberer sind die Menschen, die in der Bruderschaft zusammen wirken, weil sie höhere Wesen in ihren Kreis ziehen. … Der Zukunft obliegt es, wieder Bruderschaften zu begründen, und zwar aus dem Geistigen, aus den höchsten Idealen der Seele heraus.»[13]
Folgende Themen sollen behandelt werden:
- Die Krise der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.
- Zusammenhänge im Welt- und Gesellschaftsgeschehen in Bezug auf die Gründungsjahre der Anthroposophischen Gesellschaft (1902 – 1912 – 1923) im 33-Jahres-Rhythmus.
- 1923 – 2022 – Okkulte Hintergründe im Weltgeschehen.
- Die Vorgeschichte der anthroposophischen Bewegung und der Dreigliederung insb. im 18. und 19. Jahrhundert als Voraussetzung für Rudolf Steiners Wirken.
- Entwicklung der Gesellschaft bis 1923. Hintergründe und Risiken der Weihnachtstagung.
- Parallelen zum heutigen Gesellschafts- und Weltgeschehen.
- Die besondere Sozialgestalt der Weihnachtstagungs-Gesellschaft.
- Aspekte zu einer zeitgemässen Sozialgestalt unserer Gesellschaft aus dem Geiste der Weihnachtstagung.
- Zur aktuellen Situation, Berichte und Gespräch: u.a. Weleda – Covid und die Med. Sektion – Konsequenzen aus der Konstitutionsfrage.
- Mitglieder-Initiativen zur GV 2023: Statutenaktualisierung, Bildung eines Mitglieder-Organs, Gestaltung der Generalversammlungen u.a.
Thomas Heck
Aktuelle Termine
[1] GA 93, S. 126.
[2] Manuskript zu den Hintergründen des Kriegsgeschehens teilweise veröffentlicht unter dem Titel «Der Kampf um den russischen Kulturkeim» in: Der Europäer, 3. Jg. Nr. 5 (März 1999), S. 3 (Manuskript Archiv Perseus Verlag), hier wiedergegen nach GA 173c.
[3] GA 331, S. 36, 8. Mai 1919.
[4] «Soziale Zukunft», Zürich, 1. Jahrg., «Die Dreigliederung des sozialen Organismus, die Demokratie und der Sozialismus, 1. Heft, Juli 1919.» Heute in GA 24, S. 201.
[5] Thomas Heck, « … am Grabe aller Zivilisation?», www.wtg-99.com/Rundbrief_32, Seite 5.
[6] GA 191, S. 213.
[7] Rudolf Steiner, GA 185a, 2017, S. 148.
[8] Siehe Rundbrief «100 Jahre Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft?»
https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_31.pdf, Seite 4/5.
[9] Zitiert nach E. Zeylmans: «Willem Zeylmans van Emmichoven, ein Pionier der Anthroposophie», S. 115f.
[10] GA 259, S. 79.
[11] GA 259, S. 377.
[12] GA 224, 1992, S. 50.
[13] GA 54, 1983, S. 192f. und GA 265, 1987, S. 122.
von Thomas Heck | Jun 12, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Am Dienstag den 14. Juni 2022 findet am Goetheanum zum Thema «Impf-Empfehlung» der Medizinischen Sektion eine offenen Forum statt:
«Wo liegt die Grenze zwischen Aufklärung, die zu einer individuellen Urteilsbildung beiträgt, und institutioneller Empfehlung, die schnell als ‹ex cathedra› empfunden wird?»
Das Forum ist eine Initiative des Zweiges am Goetheanum, Uhrzeit und Ort: ab 20 Uhr im Terrassensaal des Goetheanum.
Beim Gespräch anwesend sein werden als Vertreter der veranstaltenden Zweige und des Vorstands am Goetheanum: Matthias Girke, Andreas Heertsch, Ueli Hurter, Georg Soldner, Ronald Templeton und Justus Wittich
Anmerkungen zur Vorbereitung
Ob die Verlautbarungen der medizinischen Sektion als Impfempfehlungen verstanden wurden oder nicht, mag dahin gestellt sein. Tatsache ist, dass die offizielle Haltung schon zu der sogenannten Pandemie den Narrativen des Mainstream folgte: Weder wurde das Virus als Krankheitserreger überhaupt noch die allgemein geglaubten Wege der Ansteckung durch physische Übertragung der Viren infrage gestellt, obwohl es schon auf naturwissenschaftlicher Ebene an entsprechenden Nachweisen mangelte. Auf geisteswissenschaftlicher Ebene – sofern diese überhaupt in Betracht gezogen wurde – haben die einschlägigen und eindeutigen Aussagen Rudolf Steiners keine Berücksichtigung gefunden. Rudolf Steiner:
«Der Regen kommt, wenn die Frösche quaken …
Derjenige, der behauptet, dass von den kleinen Lebewesen die Krankheiten kommen, der zum Beispiel sagt: die Grippe kommt von dem Grippebazillus und so weiter, der ist natürlich geradeso gescheit, als wenn einer sagt, der Regen kommt von den Fröschen, die quaken. Natürlich, wenn der Regen kommt, quaken die Frösche, weil sie es spüren, weil sie ja in dem Wasser sind, das angeregt ist durch dasjenige, was den Regen bewirkt. Aber die Frösche bringen nicht den Regen. Ebenso bringen die Bazillen nicht die Grippe; aber sie sind da, wo die Grippe ist, geradeso wie die Frösche auf eine unerklärliche Weise hervorkommen. wenn der Regen kommt». (Auszug, wesentlich ausführlicher in Rundbrief 28 oder https://wtg-99.com/rudolf-steiner-zur-ansteckung/).»
Diese Widersprüche gegenüber den eigenen Ansichten wurden zu keiner Zeit thematisiert! Somit hat man sich seitens der Med. Sektion, wenn man Rudolf Steiners Aussagen (noch?) ernst nimmt, in dem «modernen Aberglauben» bewegt, «dass die Bazillen und Bakterien in den Menschen einziehen und ausziehen und die Krankheiten bewirken.» Anstatt diese Widersprüche zu den eigenen Aussagen aufzuklären, wurde die Tatsache, das sich Rudolf Steiner gegen Pocken impfen lies, so dargestellt, als habe er dies als wirklich sinnvoll angesehen und sich aus innerer Überzeugung von einem gesundheitlichen Nutzen impfen lassen. Es wurde einfach unterschlagen, dass damals in Deutschland eine gesetzliche Impflicht bestand, der sich Rudolf Steiner kaum entziehen konnte. So kann der Eindruck entstehen, dass man ihn im Grunde instrumentalisierte, um die eigene Haltung zu unterstützen. War Rudolf Steiner ein Impfgegner? https://wtg-99.com/war-rudolf-steiner-ein-impfgegner/
Generell fällt auf, dass gerade in den medizinischen und naturwissenschaftlichen Fragen um Corona und die Impfung von einem freien Geistesleben keine Rede sein konnte, da andere Ansichten gar nicht erst in Erwägung gezogen und deren Vertreter – darunter auch Ärzte, die zu anderen Schlussfolgerungen als die Sektion-Leitung gekommen waren – ausgegrenzt wurden, nicht zu Wort kamen oder gar aus Verschwörungstheoretiker diskreditiert wurden.
Der Vorwurf gegenüber Thomas Mayer, das von ihm veröffentlichte Buch „Corona-Impfen aus geisteswissenschaftlicher Sicht“ sei dogmatisch, unwissenschaftlich und unseriös war eine regelrechte Projektion und betraf die Rezensenten selber: Die Kritik war ausschliesslich persönlich, zum Teil falsch (man hatte das Buch gar nicht gründlich studiert) und es wurde nicht einmal der Versuch unternommen, sachlich irgendetwas zu wiederlegen. Von einem Absolutheitsanspruch konnte man nur in Bezug auf die Beurteilung der Rezensenten (zu denen auch die Leiter der Medizinischen Sektion gehörten) sprechen – Thomas Mayer hat wohl an keiner Stelle seines Buches die dort wiedergegeben Erfahrungen und Wahrnehmungen als absolut wahr und unbezweifelbar bezeichnet. Wenn man sich vergegenwärtigt, was Rudolf Steiner selber zu den Wirkungen der Pockenimpfungen sagte, kann deutlich werden, dass es keineswegs angemessen ist, die in dem Buch geschilderten Erfahrungen a priori als abwegig zu bezeichnen:
«Es (die Pockenimpfung) schadet nur denjenigen, die mit vorzugsweise materialistischen Gedanken heranwachsen. Da wird das Impfen zu einer Art ahrimanischer Kraft; der Mensch kann sich nicht mehr erheben aus einem gewissen materialistischen Fühlen. Und das ist doch eigentlich das Bedenkliche an der Pockenimpfung, daß die Menschen geradezu mit einem Phantom durchkleidet werden. Der Mensch hat ein Phantom, das ihn verhindert, die seelischen Entitäten so weit loszukriegen vom physischen Organismus wie im normalen Bewußtsein. Er wird konstitutionell materialistisch, er kann sich nicht mehr erheben zum Geistigen. Das ist das Bedenkliche bei der Impfung. Natürlich handelt es sich darum, daß da die Statistik immer ins Feld geführt wird. Es ist die Frage, ob eben gerade in diesen Dingen auf die Statistik so viel Wert gelegt werden muß.»
Und ist es nicht so, dass inzwischen versucht wird, die Impfempfehlungen mit fragwürdigen Statistiken zu rechtfertigen?
Bleibt die Frage, ob nun das Buch von Thomas Mayer oder die grundsätzliche Haltung der offiziellen Anthroposophischen Medizin mehr Schaden angerichtet hat – für die Anthroposophie – vor allem aber für die betroffenen Menschen, die sich im Vertrauen auf die offiziellen Aussagen, die auch von anderen Institutionen (Weleda, Bund der Waldorfschulen , Demeter u.a.) übernommen wurden, haben impfen lassen. Das ist nicht nur eine medizinisch-naturwissenschaftliche – sondern insbesondere eine moralische Frage.
Inzwischen mehren sich die Hinweise auf Impfschäden und die dramatische Untererfassung dieser Nebenwirkungen kann kaum infrage gestellt werden. Aber auch weiterhin wird die Impfung empfohlen und die unhaltbaren und unwahren Aussagen zu Rudolf Steiners Haltung wurden nicht zurückgenommen:
https://www.mynewsdesk.com/de/goetheanum/pressreleases/stellung-der-anthroposophischen-medizin-zur-impfung-gegen-sars-cov-2-gesundheit-umfassend-staerken-3070644
https://www.gaed.de/corona/standortbestimmung
https://www.anthromedics.org/PRA-0971-DE
https://www.weleda.de/weleda/unsere-expertise/weleda-zu-covid-19
https://www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-faq/
https://www.demeter.de/aktuell/stellungnahme-corona
Auf die wesentlichen Aspekte wurde bereits im Frühjahr 2021 hingewiesen, die Aussagen in den Rundbriefen 28 und 29 sind auch weiterhin aktuell.
Weitere Informationen in Rundbrief 28 und 29.
Es ist höchste Zeit, dass umfassend Rechenschaft abgelegt, Verantwortung übernommen wird und Konsequenzen gezogen werden.
von Thomas Heck | Jun 5, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Ist die Weltgesellschaft überhaupt eine Realität?
Der nachfolgende Bericht ist als Reaktion auf die von Ueli Hurter verfasste Kolumne «Zum Abstimmungsgeschehen» in AWW 5/22 entstanden, wobei auch die übrige Berichterstattung über die Generalversammlung 2022 angesprochen wird. Aufgrund der reduzierten Seitenzahl von Anthroposophie weltweit ist dort eine sachgemässe Erwiderung nicht möglich und es konnte daher dort nur eine stark zusammengekürzte Zusammenfassung erscheinen (AWW 6/22). Im Anhang sind mündliche GV-Beiträge von Marjatta van Boschoten und Thomas Heck wiedergegeben.
Desweiteren wird die Frage gestellt, ob man angesichts des rapide abnehmenden Interesses der Mitglieder an der Gesellschaft überhaupt noch von einer ‹Weltgesellschaft› sprechen kann.
Zu der Kolumne «Zum Abstimmungsgeschehen»
Seitens des Vorstandes, der die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft als einen der beiden Hauptaktionäre sowohl in der Weleda-Generalversammlung als auch im Verwaltungsrat vertritt, wurden wechselnden, z.T. sich widersprechende und nicht nachvollziehbare Argumentationen für eine „Ausgliederung“ der Weleda-Aktien an eine unbekannte Institution vorgebracht. Dies hat in der Mitgliedschaft erhebliche Irritationen verursacht und zu einem deutlichen Vertrauensverlust geführt. Die Chance, diesen wieder auszugleichen, beruht auf einer Mitgliederinitiative. Darauf hätte Ueli Hurter in seiner Kolumne ruhig hinweisen können. Auch wenn gewiss nicht beabsichtigt, so werden diese Ausführungen zumindest von informierten Mitgliedern kaum als hilfreich erlebt werden, denn sie sind – auch durch das Nichtgesagte – in hohem Masse einseitig, irreführend und vermitteln kein zutreffendes Bild der tatsächlichen Vorgänge, sie würden einer sachlichen Überprüfung nicht standhalten können:
- Ja, es bestand eine Unsicherheit über die Berechtigung und Zuständigkeit des geplanten neuen Leitungsorgans. Die Ursache dafür? Wie in der Kolumne beklagt, fehlte es tatsächlich an gutem Willen – allerdings des Vorstands – auch nur im Ansatz der Mitgliedschaft den Zweck dieses neuen Leitungsorgans zu vermitteln, nicht einmal auf direkte Nachfrage hin. Zudem wurden wesentliche Teile der von mir vorgebrachten Argumente schlicht ausgelassen (diese und die Ausführungen von Marjatta van Boschoten siehe Anhang weiter unten). Ohne eine vernünftige Begründung konnte man diesem Antrag nicht zustimmen und er wäre wohl auch ohne den Geschäftsordnungsantrag abgelehnt worden. Nun ist er nur vertagt. Offensichtlich sind die entsprechenden Vorhaben aus dem Jahr 1999[1] heute im Vorstand unbekannt. Hat man auch vergessen, dass die in AWW 12/18 angekündigten Massnahmen, zu denen auch die beabsichtigte Einführung dieses neuen Leitungsorgans gehörte, bei der Besprechung an der GV 2019 auf deutlich kritische Resonanz gestossen sind?
- Gewiss hat der ursprüngliche Antrag zur Weleda Misstrauen erweckt, zu Recht, denn die wirklichen Gründe, warum die Aktien an eine andere Institution zum Nennwert übertragen werden sollten, waren vom Vorstand nicht benannt worden. Diese Art der Übertragung wird allgemein und zutreffend als verkaufen Was soll da missverstanden worden sein? Und ist es nicht einfach logisch, dass ein Wollen unverständlich bleibt, wenn die wahren Gründe für dieses Wollen nicht gesagt werden?
- «Die Eigentümerschaft einer Firma ist über den von ihr gewählten Verwaltungsrat für die Ausrichtung und Zielsetzung zuständig, partizipiert an deren Erfolg – trägt aber zugleich eine erhebliche Mitverantwortung für gedeihliche und fördernde Rahmenbedingungen des Unternehmens sowie die darin mitarbeitenden Menschen.»[2] Die Eigentümerschaft liegt bei der AAG, die sich aus der Mitgliedschaft bildet. Der Vorstand vertritt diese lediglich und ist dieser gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Tatsache ist, dass die Bevölkerung in Schwäbisch Gmünd über die örtliche Presse besser über die Entwicklungen in der Weleda informiert wird, als wir, wie z.B. über die zusätzlich geplanten Investitionen von 4,6 Millionen CHF jährlich in die Bereiche Gemeinwohl und Umwelt. Darüber war erst auf Nachfrage etwas zu erfahren. Aber auch zu den nachfolgenden Punkten, wird der Mitgliedschaft nicht ordentlich berichtet: Die wechselnden und unterschiedlichen Äusserungen zu den Streichungen der Heilmittel sind kaum einzuordnen. Wurde über Sinn und Zweck der im März 2022 neu gegründeten Weleda HealthCare AG (Arlesheim) berichtet? Kennt jemand den Zweck der Weleda Trademark AG (Arlesheim), bei der lt. Handelsregister die Markenrechte der Weleda verwaltet werden? Was geschieht mit den (vermutlich erheblichen) nicht nur deutsche Steuern sparenden dort anfallenden Gewinnen? Wie kann man – und das wurde tatsächlich geäussert – der Ansicht sein, dass diese und andere Fragen die Mitgliedschaft nicht zu interessieren haben? Es möge jeder selber einordnen wie es zu beurteilen ist, dass die eigentliche Eigentümerschaft der Weleda so gut wie gar nicht informiert und damit die bestehende Rechenschaftspflicht ignoriert wird und dieser dann auch noch vorgeworfen wird, sie habe die Lösungsansätze für ein ihr nicht erklärtes Problem nicht erkannt. «Die Menschen, die dem Goetheanum räumlich näherstehen und zur Abstimmung anreisen konnten, oft mit hohem persönlichen Aufwand aus verschiedenen Ländern, verfügen über spezifische Erfahrungen, die nicht einfach vorschnell als persönliche Aversion diskreditiert werden können…. Es bleibt, wie ich meine, eine der Herausforderungen der Zukunft, die Mitglieder der [Allgemeinen] Anthroposophischen Gesellschaft auf der ganzen Welt über die Entwicklung des Goetheanum in Licht und Schatten genauer zu informieren und ihnen zu ermöglichen, zu einer eigenständigen Urteilsbildung zu kommen.»[3]
- Mit der Einführung der Amtszeitbeschränkung im Jahr 2011 wurden besonders hehre Ziele formuliert, obwohl in Wirklichkeit etwas ganz anderes verfolgt wurde. So sollten «… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden» und «Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden.» Und weiter: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht». Diese Äusserungen erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Tatsächlich war es ein geradezu taktisches Lügengebäude, denn Paul Mackay gestand 2019 öffentlich ein, dass die Einführung [der Amtszeitbeschränkung] 2011 lediglich eine (mögliche Über-)Reaktion auf den damaligen [2011] Abwahlantrag gewesen sei! Er meinte, eine regelmässige Besinnung auf die Vorstandstätigkeit sei schon notwendig, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich![4] Hier kann man einerseits ahnen, welche Aufgaben dem neuen Leitungsorgan hätten zukommen sollen. Andererseits sind diese unwahrhaftigen Absichten jetzt bis in die Gesellschaftsverfassung, in die Statuten hinein geronnen. Jegliche Amtszeitverlängerung trägt seitdem diesen Makel einer taktischen Unwahrhaftigkeit. Peter Selg 2018 dazu: «Wenn man, so meine Auffassung, ein solches Mitgliedervotum auch in Zukunft einholen und entscheiden lassen will, so sollte das mit einem detaillierten Rechenschaftsbericht über die bisherige Amtszeit und die persönlich in ihr durchgeführten Arbeiten geschehen sowie mit einer klaren Beschreibung dessen, was in der nächsten Periode die konkreten eigenen Aufgaben sind. … Die Mitglieder sind urteilsfähig, zumindest diejenigen, die die Entwicklung des Goetheanum und der Vorstandsarbeit intensiv verfolgen; man braucht auf die Menschen nicht einzureden und sie von diesem oder jenem zu überzeugen versuchen. Man sollte vielmehr ‹in Ruhe abwarten, was die Mitglieder selber wollen› (Ita Wegman), nachdem man sie hinreichend informiert hat.» Wie treffend.
- Dem Rat Peter Selgs aus dem Jahr 2018 wurde offensichtlich wenig Bedeutung zugemessen und so die Polarisierung im Sinne einer Spaltung aktiv weiterbetrieben. Durch die Gegenüberstellung der Landesrepräsentanten gegenüber der im Saal anwesenden Mitgliedschaft, entsteht ein unangemessenes Spannungsverhältnis, was gewiss vielfach zur Recht als Polarisierung erlebt wird. Das geschah insbesondere schon 2018 und Peter Selg hatte gewarnt: «Es wurde dadurch ein Spannungsfeld zwischen den Menschen im Saal … und einer fiktiven ‹Welt› erzeugt, ein Spannungsfeld, das in Wirklichkeit überhaupt nicht existiert. Alle Tendenzen in Richtung einer kollektiven Meinungsbildung und Funktionärsgesellschaft anstelle einer Mitgliedergesellschaft sind sehr gefährlich. Darin, und nur darin, besteht für mich eine wirkliche Nähe zu 1935.»
- Die Bestrebungen, die AAG zu einer aristokratisch geführten Funktionärsgesellschaft zu entwickeln, sind seit Jahrzehnten unübersehbar – wenn man sie sehen will. Wenn man die letzten Ergebnisse der Mitgliederversammlungen in der Schweiz und in Deutschland zugrunde legt, kann sich z.B. Marc Desaules zwar auf eine 100%ige Zustimmung bei der Entlastung stützen, es waren jedoch nun 130 Mitglieder anwesend – gegenüber fast 400 noch 2018. Prozentual mit 97% nur unmassgeblich schlechter war das Ergebnis für Michael Schmock, bei lediglich 99 abgegeben Stimmen! Es war die letzte Versammlung vor Corona 2019. Will man wirklich behaupten, dass diese beiden Generalsekretäre die gesamten Landesgesellschaften repräsentieren? Hat Peter Selg nicht völlig Recht, wenn er von einer ‹fiktiven Welt› schrieb? Man vergegenwärtige sich: Nur 70-80 Mitglieder der Weltgesellschaft nutzten die Möglichkeit der Live-Online-Teilnahme. Peter Selg weiter: «Ich fragte mich auch, wen die Generalsekretäre und Landesvertreter dabei eigentlich vertreten. Können sie wirklich behaupten, für alle Mitglieder in ihrem Land zu sprechen? Ich kenne durch meine internationale Tätigkeit Anthroposophen in sehr vielen Ländern, darunter Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, die ganz anders denken als ihre Generalsekretäre, auch in dieser Frage. Letztlich stehen die Generalsekretäre und Landesvertreter für sich selbst, aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, die keinesfalls mit den Erlebnissen all ihrer Mitglieder identisch sind.»
Bericht über die Generalversammlung in Deutschland
In der deutschen Landesgesellschaft scheint der Spaltungsprozess bereits weiter fortgeschritten zu sein, offensichtlich hat die Mitgliedschaft aufgegeben, überhaupt noch an der Gestaltung der Gesellschaftsverhältnisse teilhaben zu wollen: An der Mitgliederversammlung 2019 (vor Corona) nahmen gerade noch ca. 100 Mitglieder teil, 2020 waren es noch 50 und 2021 ca. 65. Allein der Vorstand und die Vertreter aus den 11 Arbeitszentren werden in diesen Versammlungen bereits eine überdeutliche Mehrheit gebildet haben, Mitglieder ohne Amt oder Funktion werden kaum anwesend gewesen sein. Insofern ist man in der Leitung weitgehend unter sich. Ist die „Funktionärsgesellschaft“, vor der Peter Selg warnte, in Deutschland bereits Realität? So wurden an der Mitgliederversammlung der AGiD 2020 Monika Elbert, Christine Rüter und Antje Putzke in das Arbeitskollegium (Vorstand) der AGiD gewählt – überwiegend mit den Stimmen der Leitungs-Kollegen.[5]
Unfassbar und erschütternd ist der Bericht von Christine Rüter, die 2022 erstmals an einer Generalversammlung in Dornach teilgenommen hat. Was und wie sie darüber berichtet, ist weitestgehend frei von Tatsächlichkeiten und voll von Unterstellungen gegenüber den Mitgliedern, die an der Generalversammlung teilgenommen und sich für die Gesellschaft und die Weleda-Problematik engagiert hatten.[6] Diese hätten für eine aggressive Stimmung gesorgt, sich nur profilieren wollen und kleinliche Kritik geäussert. Zudem wären alle Anträge abgelehnt worden – (kein einziger Antrag wurde abgelehnt, zum Antrag zur Weleda gab es nicht einmal eine einzige Gegenstimme und der Antrag zum Landesvertreterorgan wurde lediglich vertagt!). Was Christine Rüter schreibt erfüllt die Kriterien unseriösen Journalismus, so, wie sie in einer im Auftrag der AGiD erstellten Studie formuliert wurden («Vorsicht vor unseriösen Quellen»):[7]
- Keine sachgerechte Trennung von Tatsachen und Meinung.
- Eine einseitige Selektion der Inhalte.
- Das Verschweigen von ansehensrelevanten Tatsachen.
- Keine Konfrontation der angegriffenen Institution.
- Fragwürdige Tatsachenbehauptungen.
Überzeugen Sie sich selbst.
Ist die Weltgesellschaft eine Realität?
Wenn Christine Rüter nun meint, man solle die Generalversammlungen an anderen Orten mit Online-Abstimmungsmöglichkeiten stattfinden lassen, damit nicht die ihrer Ansicht nach aggressiven Dornacher Mitglieder in der Überzahl sind, so ist allerdings fraglich, ob ihr das wirklich weiterhelfen würde: Aus der Weltgesellschaft (ca. 42.000 Mitglieder) haben sich weniger als 100 Mitglieder an der GV online zugeschaltet und an der fakultativen Abstimmung wurden online gerade einmal ca. 60 Stimmen abgegeben. Wie kann man angesichts dieser Realität noch von einer ‹Weltgesellschaft› sprechen? Ganz offensichtlich fühlt sich nur noch eine verschwindend geringe Zahl von Mitgliedern für die Gesellschaftsangelegenheiten verantwortlich – und ausgerechnet diese werden dann auch noch verunglimpft!
Das geschwundene Interesse an der Gesellschaft zeigte sich auch aufgrund einer Einladung zu einem runden Tisch (AWW 11/21). Angesprochen werden sollten Mitglieder, die sich aus Enttäuschung oder anderen Gründen von der Gesellschaft zurückgezogen haben. Die Initiatoren fragten: «Wir, die wir uns nicht zurückzogen haben, blieben wir bloß mit einem ‹Trotzdem›? Haben wir – so wir noch unseren Zweig besuchen – doch ein lokales Zuhause gefunden? Traten wir nicht alle mit den größten Idealen an? Wollten wir nicht am Kulturauftrag der Anthroposophischen Gesellschaft mitarbeiten? Im Lichte der vorgeburtlichen Entschlüsse fällt das Erreichte wohl immer etwas kläglicher aus. Sind wir tatsächlich angesichts der unerbittlichen Macht des Faktischen eingeknickt? Machen wir unsere Zweige zu ‹Auslaufmodellen›? … Wie wollen wir unsere Anthroposophische Gesellschaft dem näherbringen, was wir einst suchten?»
Dieser Runde Tisch fand Mitte März 2022 statt, mit gerade einmal 25 Teilnehmern, wovon etliche zu den Initiatoren und deren Umfeld gehört haben werden. Nicht besonders ermutigend. Auch dazu ist auf den Internetseiten der AGiD ein Bericht erschienen, der einen Einblick in die Gesellschaftssituation erlaubt (aus dem Bericht von Anke Steinmetz[8]): «Was mich als Mitarbeiterin in der Vorbereitungsgruppe irritierte, war die Vorstellung einiger Anwesenden nach dem weiteren Vorgehen. Plädoyers wurden gehalten zu Erwartungen und Forderungen zum Beispiel an die Leitung des Goetheanum, oder darüber, was unter wissenschaftlicher Arbeit zu verstehen sei. Es wurde auf das zurückgegriffen, was in früheren Zeiten doch funktioniert hatte, beispielsweise große Persönlichkeiten und Referierende einladen, selbst mehr Führung von oben wurde gefordert… anderen in der Runde schien dabei der Atem zu stocken. Sie waren mit der Frage beschäftigt: Wie kann ich selbst in meinem Handeln besser den Aufgaben entsprechen, die sich uns stellen? Was muss ich tun, um mehr Interesse an dem anderen hervorbringen zu können? Wie kann ich etwas dazu beitragen, dass reales Geisterleben in unseren Arbeitsgruppen lebt? Welche Verantwortungs- und Organisationsform ist in der heutigen Zeit fruchtbar und wie kann ich an diesen Veränderungen konstruktiv mitwirken? Die einen hatten Fragen, die anderen Antworten, aber die Antworten schienen nicht auf die Fragen zu resonieren. Es war, als kämen sie aus einer Vergangenheit und wollten anderen sagen, wie sie dieses oder jenes zu machen hätten, damit alles besser werde. Diese Haltung entzog uns allen meiner Beobachtung nach etwas den Boden für unsere ursprüngliche Intention von einer Selbstertüchtigung und von Eigenverantwortung an unserem Platz.»
So leben durchaus wichtige und entscheidende Fragen in der Gesellschaft – das Ergebnis dieses Runden Tisches ist jedoch nicht sehr ermutigend, um den Kulturauftrag einer anthroposophisch sein wollenden Gesellschaft erfüllen zu können, weder quantitativ noch qualitativ. Hat diese Gesellschaft überhaupt noch eine Zukunft, so muss man sich realistischer Weise fragen – ausgerechnet jetzt, zur unmittelbar bevorstehenden säkularen Wiederkehr der Weihnachtstagung?
Thomas Heck, 1. Juni 2022
Anhang
Geschäftsordnungsantrag zum Antrag 1 „Konferenz der Landesvertreter“, Thomas Heck
«Ich möchte gerne vorausschicken an die Adresse des Vorstandes, die Generalsekretäre und Landesvertreter: ich habe weder gegen irgendjemanden persönlich etwas, weil ich jetzt hier spreche. Und ich habe auch nichts gegen die Gremien, die sich gebildet haben. Eigentlich habe ich nur etwas „dafür“, dass dies alles ordentlich in unserer Gesellschaft gehen kann.
Es war an dieser Generalversammlung schon von Globalisierung die Rede, dass die Gesellschaft immer internationaler wird und immer weniger deutschsprachig. Wenn man in die Welt schaut, dann haben wir doch heute sehr viele Probleme, gerade mit der Globalisierung und wir haben eine allgemeine Tendenz, dass Souveränitätsrechte und nationale Rechte immer weiter von den Ländern an supranationale Organisationen übertragen werden. Wer am Zeitgeschehen einigermaßen teilnimmt wird wissen, was ich meine. Wenn heute zum Beispiel die WHO eine Pandemie ausruft, dann geht das unmittelbar durch, auch in die Schweiz, in das Schweizer Recht, wo dann der Staat handeln muss. Diese Entwicklungen sind eine eindeutige Tendenz. Und diese Tendenz geht ja weiter, bis in die in die Fragen des Impfens und vieles mehr.
Mein Eindruck ist, dass es ein falsches Signal wäre, wenn auch wir einen solchen Schritt tun und die Gesellschaftsleitung um ein Organ ergänzen. Ich möchte daran erinnern: Wir haben auch das Organ der Goetheanum-Leitung, ein Organ, das in den Statuten nicht definiert ist. Es ist dort nicht festgelegt, wie das Organ zustande kommt und die Goetheanum-Leitung ist auch der Mitgliedschaft gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Im Grunde ist das genau die gleiche Tendenz (auch bei dem Landesvertreter-Organ). Müsste man da nicht erst einmal genau hinschauen und klären, warum das so ist? Warum steht die Goetheanum-Leitung nicht als Organ in den Statuten? Und mit dem Organ der Generalsekretäre und Landesvertreter wäre das ganz ähnlich. Es würde zwar definiert, es steht aber nicht in den Statuten, wie dieses Organ zustande kommt. Und dieses Organ wäre der Mitgliedschaft gegenüber nicht rechenschaftspflichtig.
Ich habe nichts dagegen, dass dieses Organ gebildet wird, ich meine nur, dass die ganze Beratung und Auseinandersetzung mit der Mitgliedschaft zu kurz gekommen ist. Und eigentlich bräuchte es in unserer Gesellschaft die Geste – und das wäre auch ein Vorbild für das, was in der Welt notwendig ist – dass es ein Mitgliederorgan gibt. Ein Organ, das sich aus der Mitgliedschaft bildet und auf Augenhöhe mit dem Vorstand und der Goetheanum-Leitung, also mit den Gremien, die die Gesellschaft leiten, verhandeln kann, sich austauschen kann. Das müsste nach meinem Verständnis aus der Mitgliedschaft, aus einer Initiative der Mitgliedschaft und nicht vom Vorstand ausgehend gebildet werden.
Nun würde ich diesem Vorschlag für das neue Organ ungerne zustimmen, ich möchte aber auch nicht dagegen stimmen. Und ich will mich eigentlich auch nicht enthalten. Denn ich glaube, wir brauchen diesen Zugriff bis in die Statuten.
Mein Vorschlag ist: Lassen Sie uns das verschieben. Die Organe und die Arbeitszusammenhänge, die da sind, die können weiter arbeiten und werden durch diesen Beschluss, der jetzt gefasst werden soll weder begünstigt noch behindert, wenn er nicht gefasst wird. Aber lassen Sie uns doch noch ein Jahr Zeit, oder auch länger Zeit nehmen, dass das bewegt werden kann. Dazu möchte ich nun den Geschäftsordnungsantrag stellen, dass der Antrag des Vorstandes auf unbestimmte Zeit vertagt wird. Ich würde auch nicht sagen, wir treten gar nicht ein, nicht dass der Antrag weg ist. Aber lassen Sie uns ihn vertagen – und auch nicht vergessen. Das wird dann ihre Aufgabe sein. Vielen Dank.»
Am Sonntag, 12. April 2022, Marjatta van Boeschoten
«Ich stehe hier, weil ich von gestern sehr besorgt bin und zwar, weil ich zwei ganz verschiedene Bilder in mir trage. Gestern vor dem Mittag waren viele von Euch in kleinen Gruppen (Arbeitsgruppen) und ich war mit meinem Kollegen aus den USA, John Bloom, zusammen in einem Büro und wir haben mit der Englisch sprechenden Welt online gesprochen. Das war zum ersten Mal, dass das möglich war in einer Generalversammlung. Und sie konnten auch zuschauen, was hier im Saal vorging. Wir haben 1 ¼ Viertelstunden gesprochen. Sie kamen aus Japan, Australien, Russland, Rumänien, viele EU-Länder und sie haben so rührend mit so viel Dankbarkeit gesprochen, dass sie hier angeschlossen sein können. Dass sie mit uns in diesem Saal endlich mitmachen können. Ich war wirklich überrascht, und ich habe zuletzt gesagt, als wir uns verabschiedeten, wie ich mich freue, diese neue Beziehung machen zu können und würde das im Herzen tragen durch den Rest dieser Generalversammlung und gestern Nachmittag natürlich auch. Ich hatte dieses Bild in mir.
Dann hat Justus Wittich beschrieben, wie wir, die Generalsekretäre, zusammen mit dem Vorstand ein neues Organ machen möchten, das, was wir schon lange gemacht haben, das würde jetzt offiziell werden. Und dann kam so ein Widerstand, den die ganzen Leute und die Welt gesehen haben. Und in dieses Gespräch hinein ist eine Beziehung gemacht worden zwischen dem, was wir als Generalsekretäre mit unseren Kollegen hier im Goetheanum machen möchten und der WHO. Und ich weiß nicht, ob sie gespürt haben, was ich gespürt habe, ob ich es mir eingebildet habe. Mit diesen Worten kam ein Virus von Furcht durch den ganzen Saal. Eine ganz andere Stimmung ging von dem aus, als was wir als Generalsekretäre zusammen mit unseren Kollegen einbringen wollten. – Es ging nicht. Im Englischen würde man sagen: It got kicked into the long grass, ins lange Gras, wo man es nicht mehr finden kann. Niemand hat gesagt: Interessante Sache, gute Idee. Das kann man machen, ja, es gibt Probleme, wir müssen darüber denken. Aber es soll weiter (gehen). Das war für mich und ich glaube auch für meine Kollegen war das sehr schmerzhaft. Wir kommen aus Ländern, die auch hierher gehören, genau wie Sie (im Saal) fühlen, dass sie dazugehören. Nur können Sie nicht die Reise machen. Aber sie haben Plätze hier. Und wir wollen das aufmachen, dass sie jetzt zuhören können, sehen können und mitmachen können. Und ich fühle, wir haben hier zwei verschiedene Welten. Und wenn wir Gesellschaft wollen, wenn wir in die Zukunft sehen wollen, in die nächsten 100 Jahre, ist das ein Problem. Das muss aufgenommen und gelöst sein.»
Langer Beifall folgte, Matthias Girke, am Rednerpult, klatschte lange nach und sagte: «Ganz herzlichen Dank, Marjatta für diesen sehr wichtigen und ich glaube auch zukunftsweisenden Beitrag von Dir.»
Das Interesse der Mitglieder aus der Welt kam in der Online-Beteiligung deutlich zum Ausdruck: Im deutschsprachigen Online-Kanal nahmen max. 60 – 80 Zuschauer insgesamt teil, im englischsprachigen deutlich und im spanischen Kanal noch weniger. Ins Französische wurde gar nicht übersetzt. An den Abstimmungen nahmen weltweit gerade einmal 50 bzw. 60 Mitglieder online teil.
In einem Beitrag von 2018 hatte Peter Selg die Frage gestellt, wen die Generalsekretäre und Landesvertreter eigentlich vertreten. Wenn man die Beteiligung an Mitgliederversammlung zugrunde legt – und dort wird ja über die Besetzungen abgestimmt. An der deutschen Mitgliederversammlung (insgesamt ca. 12.500 Mitgliedern, 30% der Gesamtmitgliedschaft) nahmen 2016 noch 200 Mitglieder teil, 2017 waren es 150, 2018 und 2019 jeweils 100. Das sind 0,8 – 1,6 % der deutschen Mitglieder, die die jeweilige Gesellschaftsleitung bestätigen.
[1] Siehe: https://wtg-99.com/papierkorbentwurf99.
[2] Justus Wittich in AWW 7-8/21.
[3] Anthroposophie weltweit 5/18.
[4] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 1. Juni. 2022).
[5] https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/zur-mitgliederversammlung-der-deutschen-landesgesellschaft
[6] https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/ist-die-weltgesellschaft-regional-oder-global
[7] https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/vorsicht-vor-unprofessionellen-quellen
[8] https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/grosser-runder-tisch. Hervorhebung TH.
von Thomas Heck | Apr 3, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Nachdem an dem Mitgliederforum am 29. März 2022 am Goetheanum deutlich geworden war, dass es erheblichen Gesprächsbedarf seitens der Mitgliedschaft zu den Absichten des Vorstandes bzgl. der Weleda gibt, wurde ein weiteres Treffen noch vor der Generalversammlung vereinbart:
Mitgliederforum am Goetheanum
Einziges Thema: Weleda
Montag, 4. April 2022, 20 Uhr
Ort: Goetheanum (vermutlich im Halde-Saal)
Veranstalter: Zweig am Goetheanum
Zur Weleda
Nach den Äusserungen des Vorstandes an dem Mitgliederforum vom 29. März 2022 und den Ausführungen in AWW 4/22 in Bezug auf die Abstimmung zur Weleda an der Generalversammlung scheinen nun alle Klarheiten beseitigt: Es ist unklar, ob an der GV überhaupt in Bezug auf die Weleda etwas entschieden bzw. worüber abgestimmt werden soll. Was geschehen soll, wird erst an der Generalversammlung mitgeteilt. Nur soviel scheint (unverbindlich) klar zu sein, dass eine endgültige Entscheidung erst an einer a.o. GV in der 2. Jahreshälfte 2022 von der Mitgliedschaft getroffen werden soll. Weiterhin kursiert jedoch die Aussage eines Mitglieds des Schweizer Landesvorstandes, dass jetzt gar nicht über die Weleda abgestimmt werden soll.
Ob und worüber auch immer an der GV abgestimmt werden soll: Eine breite Beteiligung an der diesjährigen GV ist sehr wünschenswert, damit ein aussagekräftiges Abstimmungsergebnis bzw. Stimmungsbild möglich wird, ganz unabhängig vom Ergebnis. Das ist insbesondere für den Vorstand wichtig, für einen klaren Auftrag von der Mitgliedschaft, in welche Richtung überhaupt gedacht werden soll.
Verkauf der Aktien – eine unsachliche Aussage?
In «Anthroposophie weltweit 1-2/22» wurde deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass nach dem Willen des Vorstandes der Aktienbesitz inklusive der Partizipationsscheine (PS) an der Weleda an eine Stiftung (oder an eine andere Organisation?) übertragen werden soll. Diese Übertragung soll zum Nennwert erfolgen. Dabei handelt es sich um den Wert, zu dem die Aktien bzw. die PS ausgegeben wurden (der aktuelle Zeitwert liegt um das ca. 10-fache höher). In AWW 4/22 kommt weiterhin klar zum Ausdruck, dass die Verhältnisse so gestaltet werden sollen, dass von der Mitgliedschaft eine Mitsprache in Bezug auf die Weleda und den Aktienbesitz in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Dazu wird es als erforderlich angesehen, dass die Aktien nicht mehr im Besitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sind, dann also einer anderen Organisation gehören würden, welche die Rechte an dem Aktienbesitz inklusive der Stimmrechte halten wird.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die dazu führen, dass der Aktienbesitz in andere Hände gelangt:
- Durch Übertragung ohne Gegenleistung, landläufig «schenken» genannt.
- Durch Übertragung zu einem bestimmten Wert, d.h. es erfolgt eine Gegenleistung (z.B. in Form einer Bezahlung, eines Natural-Tausches oder es wird ein Darlehen gewährt). Dieser Vorgang wird landläufig als «verkaufen» bezeichnet, was an und für sich kein unmoralischer Vorgang ist. Dabei ist vollkommen unerheblich, wie man diesen Vorgang nennt, ob «Übertragung zum Nennwert», «Neugliederung» oder eben «Verkauf». Einen sachlichen oder qualitativen Unterschied gibt es nicht.
Die Aussage «Übertragung zum Nennwert» ist eine klare Aussage und es ist absolut sachgemäß, von «verkaufen» zu sprechen, da es sich nicht um einen Schenkvorgang handeln soll.
Transparente Information?
Obwohl in dem Beitrag in AWW 4/22 mehrfach von Transparenz die Rede ist, sind die Absichten des Vorstandes auch weiterhin insgesamt undeutlich, durch die neuen Verlautbarungen sogar noch nebelhafter geworden. Es ist eher das Gegenteil von transparenter Information. Oder aber die ganze Angelegenheit ist bisher so wenig durchdacht, dass man selber noch gar nicht weiss, wie das alles gehen soll. Dafür spricht manches, auch informelle Verlautbarungen aus dem Goetheanum.
Klar erkennbar ist aber der Wille, einen Weg zu suchen, um eine zukünftige Mitgliedschaft sowie einen zukünftigen, möglicherweise verantwortungslosen Schatzmeister daran zu hindern, im Falle eines Falles mit Hilfe des Aktien- bzw. Partizipationsscheinbesitzes mögliche Bilanzprobleme zu lösen bzw. durch Veräusserung Haushaltsdefizite zu decken und/oder ggf. eine Insolvenz zu vermeiden. Erinnern wir uns bitte, dass unter der Führung des aktuellen Schatzmeisters einerseits immer wieder Gesellschaftsvermögen (Liegenschaften) zur Deckung von Haushaltsdefiziten (das strukturelle Defizit) verkauft wurden. Und es ist nach den Erfahrungen der letzten Jahre zu erwarten, dass ein zukünftiger Nachfolger dieses dauerhaft bestehende strukturelle Defizit erben wird. Nun soll dem zukünftigen Schatzmeister unter anderem genau die Möglichkeit verwehrt werden, die der aktuelle zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung für das Rechnungsjahr 2017 genutzt hatte: eine (durchaus moderate) Anpassung des Wertes der Partizipationsscheine!
Eine moderate Anpassung der Werte der Partizipationsscheine in der Bilanz ist nicht das eigentliche Problem. In einer Notsituation kann das durchaus eine sinnvolle Massnahme sein. Das Problem war und ist das weiterhin bestehende strukturelle Defizit.
Mit der Zustimmung zu der beabsichtigten Übertragung der Aktien und Partizipationsscheine soll also die Gesellschaft in gewisser Weise vor sich selbst geschützt werden, damit sie nicht wie Odysseus den Verlockungen der Sirenengesänge unterliegt, die für ihn den sicheren Untergang bedeutet hätten, wäre er diesen erlegen. Stellt sich allerdings die Frage, ob für die Gesellschaftssituation nicht das Umgekehrte gilt: Wenn die Gesellschaft endgültig und unwiderruflich sich der Möglichkeit begibt, im Falle einer Notsituation auch über das Aktien- und Partizipationsschein-Kapital in verantwortlicher Weise und im Rahmen der bestehenden Regeln (siehe weiter unten) verfügen zu können, so kann heute noch nicht abgesehen werden, welche Folgen das haben kann. Als vor Jahren die Hälfte der Partizipationsscheine mit Gewinn an eine Vermögensverwaltung weiterverkauft wurde, hat man das sicher auch für einen richtigen Weg gehalten. Aus heutiger Sicht ein schwerer Fehler, was auch vom Vorstand ganz klar so gesehen wird.
Kann man denn heute wissen, was in 5, 10 oder 20 Jahren notwendig und richtig sein wird? Hält man sich im Vorstand wirklich für so weitblickend, um die weitere Entwicklung vorhersehen zu können und heute bereits festlegen muss, was eine zukünftige Mitgliedschaft und ein zukünftiger Vorstand auf keinen Fall darf? Dass man glaubt, diese vor sich selber schützen zu müssen, indem man eine Entscheidung trifft und damit dieses ideelle und finanzielle Gesellschaftsvermögen endgültig und irreversibel ausgliedert (aufgibt, verkauft, überträgt oder wie immer man das nennen mag)? Meint man wirklich, selber moralisch und sachlich bereits heute eine Entscheidung für eine zukünftige Gesellschaftsrealität treffen zu können und die Handlungsspielräume – vollkommen unnötig, wie sich zeigen wird – einschränken zu müssen?
Vermeintliche Gefahren für die Weleda
Mit folgenden vermeintlichen «Gefahren» werden die Absichten begründet:
Erstens: Es bestünde ein Compliance-Problem, wobei dies jetzt in AWW 4/22 allerdings in den Hintergrund getreten ist, nur noch erwähnt wird. Dieses Compliance-Problem mag zwar «rechtlich beschreibbar» sein, allerdings sind die Regelungen in den Statuten der Weleda ganz eindeutig (und darüber kann sich jeder, der Aktien oder Partizipationsscheine erwerben will, zuvor informieren): Es gehört zum statuarisch festgelegten Unternehmenszweck der Weleda, anthroposophische Institutionen zu unterstützen und zu fördern! In diese Kategorie fällt auch die AAG mit der Hochschule. Hinzu kommt, dass diese Spenden seit vielen Jahren jährlich erfolgen, auch darüber kann ein möglicher Erwerber informiert sein. Statuarisch ist dieses Vorgehen klar geregelt und so wurde auch von Justus Wittich eingeräumt, dass dieses Vorgehen höchstwahrscheinlich rechtssicher in Ordnung sei. Insofern stellt sich die Frage, ob dieses theoretische (und vermutlich vermeintliche) Compliance-Problem jemals real werden könnte. Eine juristische Einschätzung scheint es nicht zu geben, da eine entsprechende Nachfrage beim Schatzmeister (nebst zweifacher Erinnerung) bis heute (3. April 2022) ohne Reaktion blieb. Muss nun aus einer Mitgliederinitiative heraus eine notwendige juristische Einschätzung eingeholt werden? Solange eine solche der Mitgliedschaft in überprüfbarer Form nicht vorliegt, sollte nicht einmal eine unverbindliche Richtungsentscheidung getroffen werden und eine weitere Diskussion unterbleiben.
Zweitens: Durch die Auslagerung des Aktien- und Partizipationsschein-Besitzes soll sichergestellt werden, dass dieser nicht durch Verkauf auf den freien Markt gelangen kann. Das könne dazu führen, dass z.B. durch profit-orientierte Aktionäre die Ausrichtung des Geschäftszweckes der Weleda abweichend von den ursprünglichen Intentionen beeinflusst und damit auch die jährlichen Spenden an die AAG in Frage gestellt werden könnten. So zumindest kann man das Ansinnen des Vorstandes verstehen. Auch das hört sich zunächst sinnvoll an, ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Allerdings stellt sich die Frage, ob denn diese Gefahr überhaupt besteht. Selbst wenn in der AAG die totale Verantwortungslosigkeit in dieser Frage ausbrechen würde oder wenn gar im Falle eines Konkurses der Gesellschaft im Rahmen einer Zwangsvollstreckung die Aktien und die Partizipationsscheine zu Geld gemacht werden sollten, besteht diese Gefahr nicht. Das ergibt sich aus den Statuten der Weleda AG. Denn man hat für genau dieses mögliche Szenario bereits vorgedacht. So heisst es in §6 der Weleda-Statuten(Auszug):
«Die Namenaktien dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft übertragen werden. Der Verwaltungsrat kann die Übertragung verweigern, wenn der vorgesehene Erwerber nicht Mitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, Dornach (Kanton Solothurn/ Schweiz), ist und somit nicht hinreichend dokumentiert, dass er die anthroposophische Zielsetzung der Weleda AG als berechtigt anerkennt und unterstützt, …
Auch bei Erwerb durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung kann der Verwaltungsrat die Eintragung in das Aktienbuch verweigern, muss aber dann dafür sorgen, dass die Aktien zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches übernommen werden. Um wirksam zu sein, müssen die Übertragungen im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sein.»
An dieser Regelung kann die AAG allein nichts ändern, es müsste also zu einem theoretischen Veräusserungswillen der AAG auch die Zustimmung des Verwaltungsrates hinzukommen. Aber selbst wenn ein solcher Coup gelingen sollte, sind die Aktien immer noch nicht frei handelbar, es bleiben Namensaktien, die an der Börse nicht handelbar sind. Und um dies zu ändern, wären noch höhere Hürden zu überwinden, denn für eine dazu notwendige Statutenänderung wäre in der Generalversammlung der Weleda nicht nur eine Zustimmung von 2/3 der Stimmrechte notwendig, sondern auch noch zusätzlich die absolute Mehrheit des Aktienkapitals. Eine nicht leicht zu überwindende Hürde, die eine ausserordentlich breite Zustimmung in der Generalversammlung der Weleda erfordern würde. Hier müssten AAG und Klinik schon gemeinsame Sache machen. Konkret heisst das, dass sowohl der Vorstand der AAG, als auch die Mehrheit einer GV der AAG, eine Mehrheit der Klinik-Leitung und eine 2/3-Mehrheit der Weleda-GV sich einig sein müssten, diesen Weg zu gehen. Ist es wirklich notwendig, sich mit grossem Aufwand davor zu schützen?
Ist eine Stiftung die Lösung?
Eine Stiftungs-Lösung ist vermutlich eher eine Gefahr als eine Lösung. Es liegt im Wesen einer Stiftung, dass sie von aussen nicht beherrscht werden kann wie z.B. eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH. Der Stiftungsrat ist das höchste Organ und kann z.B. in seinem Handeln nicht an die Weisung eines AAG-Vorstandes gebunden werden. Ob es rechtsichere Gestaltungen gibt, die dennoch ermöglichen würden, dass der Stiftungsrat nur Entscheidungen treffen kann, die im Interesse der AAG liegen bzw. nur im Einvernehmen mit dem Vorstand der AAG handeln kann, ist sehr fraglich. Und ob es wünschenswert ist, dass eine Verwaltung dieses doch besonderen ideellen Gesellschaftsvermögens unter staatlicher Aufsicht erfolgen soll, ist gewiss ebenfalls fraglich. Man vergegenwärtige sich, dass auch die Alanus-Hochschule und die Universität Herdecke ihren Status nur unter staatlicher Aufsicht bzw. mit staatlicher Anerkennung haben können. Wäre das wirklich für die Verwaltung dieses Vermögens und den Einfluss auf die Weleda wünschenswert? Zudem weiss man nicht, wie sich der staatliche Einfluss zukünftig entwickeln kann. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung, wäre eine Rückabwicklung nicht möglich!
Zwischenfazit
Die vorgetragenen vermeintlichen Gefahren, mit denen die Ausgliederung der Aktien und der Partizipationsscheine gerechtfertigt werden soll, bestehen, wenn überhaupt, ganz offensichtlich keinesfalls in einem so bedrohlichen Mass, dass ein vorauseilendes Handeln jetzt notwendig oder gerechtfertigt erscheint, zudem damit erst zukünftig erkennbare sinnvolle Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bereits jetzt beschränkt oder verunmöglicht würden.
Von der Mitgliedschaft wird die bisherige Entwicklung der Weleda durchaus als problematisch gesehen, so u.a. folgende Punkte:
- Streichung zahlreicher Medikamente.
- Die Absicht, die Querfinanzierung der Heilmittel aus Kosmetik-Erträgen zumindest zu reduzieren.
- Die Verlagerung der Heilmittelproduktion nach Deutschland, obwohl dort in der EU die Gefahr eines Verbotes von Naturheilmitteln viel grösser ist als in der Schweiz.
- Immer weniger erkennbare anthroposophische Ausrichtung des Unternehmens.
- Einrichtung von Wellness-Zentren (Weleda-City-Spa).
- Fehlentwicklungen in der Vergangenheit, die fast zur Zahlungsunfähigkeit der Weleda geführt hätten (unnötiges und sehr teures Verwaltungszentrum Basel mit mehreren Millionen CHF Aufwand pro Jahr. Inzwischen aufgegeben, womit eine positive Unternehmensentwicklung einherging!).
- Zweckänderung des Unternehmens, um Spenden in Höhe von ca. 4,5 Mio. CHF jährlich an offensichtlich nichtanthroposophische Einrichtungen geben zu können. (Es handelt sich um den 3-fachen Betrag, den das Goetheanum jährlich erhält! 2022 sollen schwerpunktmässig die Bereiche Biodiversität, Bodengesundheit, Klimaschutz, nachhaltigere Verpackungen sowie gute Unternehmensführung (Governance) und Gemeinwohl gefördert werden. Inwieweit es sich dabei um anthroposophische Projekte handelt, ist nicht erkennbar und wurde nicht erwähnt.)
Diese Entwicklungen sind seitens der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft nicht von der Mitgliedschaft, sondern vom Vorstand (zusammen mit der Goetheanum-Leitung und der Medizinischen Sektion) zu verantworten.
Die Mitglieder wurden über all diese Vorgänge nicht informiert, geschweige, dass darüber Rechenschaft abgelegt wurde. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen: Vor wem muss die Weleda geschützt werden? Gewiss nicht vor den Mitgliedern!
Es wird höchste Zeit, dass aus der Mitgliedschaft heraus die Verantwortung auch für die Gesellschaft endlich ergriffen wird!
Alternative Lösung
Wenn es darum geht, die Verfügungsmöglichkeiten über den Aktien- und Partizipationsschein-Besitz innerhalb der AAG zu beschränken bzw. zu erschweren, gäbe es eine einfachere Lösungsmöglichkeit: In den Statuten wäre zu regeln, dass über die Aktien und die Partizipationsscheine nur mit 2/3 (oder 3/4?) Mehrheit in der GV verfügt werden kann. Zusammen mit den Regelungen der Weleda-Statuten müsste damit einem möglichen Missbrauch in weitestgehend vorgebeugt sein.
Externe Berater?
Wer sind die externen Berater, die diese Vorgehensweisen empfehlen? Was befähigt diese, im Interesse der Anthroposophie und der AAG sinnvolle Gestaltungen vorzuschlagen, für die der Mitgliedschaft keine schlüssigen und nachvollziehbaren Problembeschreibungen vorgelegt wurden?
Abschluss-Fazit
Zum angeblichen Compliance-Problem: Ohne eine auch für die Mitgliedschaft überprüfbare juristische Beurteilung, dass dieses Problem überhaupt besteht, sollte dieser Punkt nicht weiter verfolgt werden. Allenfalls könnte dem Vorstand der Auftrag erteilt werden, z.B. bis zum 30. Juni 2022 ein entsprechendes Rechtsgutachten vorzulegen oder aber von der Weiterverfolgung dieser Frage abzusehen. Eine ausserordentliche GV ist dann auch nicht notwendig.
Schutz der Mitgliedschaft vor sich selbst: Es besteht keinerlei Anlass, die Mitgliedschaft oder einen zukünftigen Vorstand vor einem Problem zu schützen, wo es schon genug Schutz gibt. Allenfalls könnte beschlossen werden, dass Verfügungen über die Aktien und die Partizipationsscheine nur mit qualifiziertem Mehr verfügt werden kann. Eine solche Statutenänderung könnte an der GV 2023 beschlossen werden. Eine a. o. GV ist dafür nicht erforderlich.
Ist es sinnvoll und entspricht es der Aufgabe der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, wenn die Weleda-Beteiligung und damit die Verantwortung endgültig und unwiderruflich an eine Organisation übertragen wird, die weder von der Mitgliedschaft legitimiert noch dieser gegenüber rechenschaftspflichtig ist? Das ist die Frage vor der wir stehen.
Thomas Heck, 3. April 2022
von Thomas Heck | Mrz 31, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
«Nach den Corona-Erfahrungen: Was müssen wir als Anthroposophische Gesellschaft lernen?»
Vorbemerkung
Am 29. März 2022 fand ein Mitgliederforum am Goetheanum zu den Erfahrungen im Umgang mit Corona statt. Dazu hiess es in der Einladung:
«Der Zusammenhalt in einer Gesellschaft wie der Anthroposophischen zeigt sich auch darin, wie wir zusammenwirken und wie wir uns bei unterschiedlichen, ja polaren Auffassungen verständigen. Wir laden Sie daher herzlich ein, zum Thema ‹Nach den Corona-Erfahrungen: Was müssen wir als Anthroposophische Gesellschaft lernen?› ins Gespräch zu kommen. Wir möchten erfahren, wie Sie den Umgang mit den Corona-Massnahmen erlebt haben und wie wir Wege finden, um auch in Gegensätzen doch miteinander eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Dazu findet ein Mitglieder-Forum am 29. März 2022, 20 Uhr in der Rudolf-Steiner-Halde statt.»
Es hatten sich knapp 60 Menschen eingefunden und es entstand recht bald ein lebhaftes Gespräch. Angesichts der bevorstehenden Generalversammlung mit doch brisanten Themen kamen auch die Fragen zum Umgang mit dem «Weleda-Besitz» der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft zur Sprache.
An dieser Stelle eine wichtige Information zum Antrag des Vorstandes: Dieser Antrag soll in der Richtung verändert werden, dass an der kommenden Generalversammlung zwar ein Richtungs-Entscheid, jedoch noch kein endgültiger Beschluss gefasst werden soll. Dieser soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung in der 2. Jahreshälfte 2022 erfolgen, sofern ein entsprechender Richtungsentscheid jetzt am 9. April 2022 von der Mitgliedschaft gefasst wird.
Angesichts der bevorstehenden Generalversammlung und der begrenzten Zeit, soll nun am kommenden Montag, den 4. April 2022, um 20 Uhr ein weiterer Gesprächsabend ausschliesslichen zum Thema «Weleda» stattfinden.
Nachfolgend ein erster Stimmungsbericht von Eva Lohmann-Heck aus der gestrigen Veranstaltung.
Nachklang zum Prozess und Zukunftsfragen
Sehr wichtig und anregend erlebte ich den gestrigen Mitglieder-Abend in der Halde. Wie immer in solchen Zusammenkünften lebt der Wunsch und die Hoffnung auf Verständigung und einen fruchtbaren Austausch. Deutlich wurde auch in den Beiträgen das Bemühen, dies zu ermöglichen, herzlichen Dank in dieser Hinsicht auch an Ronald Templeton für seine Gesprächsleitung!
Selbstverständlich sollte es möglich sein in einer Anthroposophischen Gesellschaft, dass im Sozialen alle Sichtweisen und Auffassungen ihre Berechtigung haben und leben dürfen, zumal man voraussetzen kann, dass alle auf der Suche nach einer Erkenntnis der Wahrheit und Wirklichkeit streben.
Im Konkreten stehen wir immer aufs Neue vor der Aufgabe, wenn sich die Sichtweisen sehr unterscheiden, wie man nicht nur zu einem Sich-Geltenlassen in den Verschiedenheiten kommt – womit ja bereits eine wichtige Qualität erreicht wäre – sondern wie ein echtes Erkenntnis-Gespräch möglich werden kann? – Zu den Voraussetzungen gehören selbstverständlich Qualitäten und soziale Fähigkeiten, wie z.B. das Interesse an den Gedanken des anderen und an dem, was im anderen lebt, Wohlwollen und „allgemeine Menschenliebe“, das schlichte Sich-Ausreden lassen – und die Toleranz gegenüber „menschlichen Schwächen“ (– der eine spricht zu leise, der andere zu laut, einer zu langsam, der andere zu schnell usw.…). Diese Qualitäten habe ich auch an gestrigen Abend erlebt. Es wurden die mitgebrachten Fragen und Themen kurz dargestellt, eine schöne Vielfalt ergab sich, im Laufe des Gespräches wurden natürlich auch die Unterschiede immer deutlicher. Jemand brachte zu Recht zum Ausdruck, wie unmöglich es sei, wenn man vom anderen nicht nur ein Denken sondern auch ein Handeln erwartet oder gar fordert im eigenen Sinne.
Meist enden die Veranstaltungen in diesem Nebeneinander –Stehenlassen der Meinungen. In diesem Falle ist eine Fortsetzung geplant für den kommenden Montag. Die Stimmung blieb konstruktiv und ich hatte den Eindruck, dass doch mit offenem Herzen alles wahrgenommen worden war. Am Montag wird es konkret nochmals um das Thema Weleda gehen, um die offenen Fragen bzw. um etwaige Missverständnisse zu klären. Dann werden wir uns voraussichtlich in kleinerem Kreise und, wenn andere hinzukommen, in einer neuen Zusammensetzung wieder finden. Damit beginnt ein neuer Prozess.
Es werden womöglich erneut sehr unterschiedliche Denk- und Willensrichtungen zu Tage treten und die verschiedenen Sichtweisen nebeneinander „im Raum“ stehen, was dann? Dazu einige grundsätzliche Gedanken, zu der Frage, wie gegensätzlichen Auffassungen künftig in einen echten gemeinsamen Erkenntnisprozess übergeführt werden könnten. Ein erster Schritt hierzu könnte sein, so meine Erfahrung, sich darüber zu verständigen, auf Grund welcher Informationen oder Kenntnisse man zu seinem Urteil gekommen ist. Welches sind die Fakten bzw. Informationsquellen? Am Beispiel der Corona-Zeit: Wenn ich weiss, dass der andere sein Wissen ausschliesslich aus der Tageschau und der Tagespresse bezieht, auf den „Faktencheck“ vertraut und dort meine Aussagen überprüfen und widerlegen lässt, so kann ich wissen, dass er zu anderen Urteilen kommen m u s s als ich. – Und wem in unseren Zusammenhängen die Aussagen Rudolf Steiners über das Impfen oder die Hintergründe der Weltpolitik, die Ziele der Gegenmächte usw. unbekannt sind, der muss ebenfalls zu anderen Urteilen über das Zeitgeschehen kommen als ich. Konkret zum Thema Weleda: Welches sind die Gründe für die geplante Ausgliederung und welches die gesetzlichen Vorgaben, welche dies erfordern? Wie wird die Aufgabe der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft als Hauptaktionärin gesehen sowie die Aufgabe des Vorstandes als ihr Vertreter im Verwaltungsrat der Weleda? – Vielleicht treten schon hier unterschiedliche Auffassungen zu Tage, die letztlich auf die noch grössere Frage zurückführen, welche gestern Abend ebenfalls geäussert wurde: Wie ist „unser“ Bild beziehungsweise welche Bilder leben von der Aufgabe der AAG? Rudolf Steiner sprach von dem dringend notwendigen gemeinsamen Aufgabenbewusstsein. Müssten wir diese Aufgabe nicht gemeinsam finden und formulieren? Dies kann keinesfalls die Aufgabe des Vorstandes ohne die Mitgliedschaft sein!
Im Falle einer Gesprächsrunde zwischen Mitgliedern, Vorständen und Sektionsleitern kommt auch noch die ungleiche Rollen – und Aufgabenverteilung hinzu. Denn um in ein echtes Erkenntnisgespräch zu kommen, darf es keinen Handlungs-und Ergebnisdruck geben, nur echtes Interesse an der Wahrheit bzw. in diesem Falle an der Weleda und ihrer Aufgabe sowie die Verantwortung der AAG in Bezug auf die Entwicklungsrichtung dieses Unternehmens. Justus Wittich sprach auch von Missverständnissen, die es in der Kommunikation gab und dass man den Mitgliedern das Vorhaben besser erläutern müsste. (Leider erinnert mich dies etwas an die Aussagen von Politikern, man müsse der Bevölkerung die geplanten Massnahmen nur besser erklären….) Die Weichen sind gestellt und die Entschlüsse gefasst, insofern wäre es gut, sich in Bezug auf den kommenden Montag realistische Ziele zu setzen, angesichts des fortgeschrittenen Stadiums des Prozesses, jedoch auch sich ins Bewusstsein zu rufen, dass die Letztverantwortung bei den Mitgliedern liegt.
Die Wahrnehmung der Mitglieder-Ansichten in Fragen von solcher Tragweite in einer gemeinsame Bildgestaltung vor der Beschlussfassung wäre da im Sinne anthroposophischer Arbeitsmethodik vielleicht ein Weg für die Zukunft?
Ich glaube, es würde viel Zeit und Kräfte sparen, wenn wir uns zuerst über unsere Erkenntnisgrundlagen verständigen würden im oben beschriebenen Sinne. Dies wäre jedoch nur der erste Schritt, er garantiert noch keineswegs, dass man zum gleichen Urteil kommt. Denn unsere Verschiedenheiten reichen selbstverständlich tiefer und weiter, nämlich in unsere charakterologischen Anlagen und – unbewussten Interessen, Neigungen und Intentionen. Diese immer mehr ins Bewusstsein zu heben ist Aufgabe der Schulung und ein langer Weg…
Soziale Gestaltung
Ich sehe kein Problem darin, wenn in unserer Gesellschaft unterschiedliche Auffassungen nebeneinander bestehen – das ist normal und gehört zu einem freien Geistesleben. Ein Problem entsteht erst, wenn nur ein Teil dieser Sichtweisen die Möglichkeit erhält, sich allen anderen und der Öffentlichkeit mitzuteilen, sprich, wenn zufälligerweise nur diejenigen Repräsentanten der AAG oder Institutionen sich öffentlich in der Wochenschrift und in AWW äussern können, deren Sichtweisen im Einklang stehen mit den politischen mainstream- Medien. Auch wenn die Beiträge – wie von Ueli Hurter betont wurde – individuell entstanden sind, gingen sie doch alle in die gleiche Richtung.
So wurden andersartige Sichtweisen unterdrückt – genauso wie in der Politik – und ein wissenschaftlicher Austausch wurde ebenfalls vermieden – genauso wie in der Politik. – Noch vor 20 Jahren gab es die Möglichkeit zu ausführlichen Stellungnahmen und über mehrere Ausgaben der Wochenschrift sich erstreckende inhaltliche Debatten! Das wäre echte Einbeziehung der Mitgliedschaft und würde der Urteilsbildung dienen. – Nun werden Sie sagen: Jeder kann sich doch per Leserbrief äussern! Das stimmt auch nicht. Kleine Erfahrung vor Jahren: Auf meinen Lesebrief erhielt ich erst auf mehrere Nachfragen hin nach Wochen eine Antwort, und in der hiess es, es gab leider zu viele Leserbriefe – und nun sei das Thema ja vorbei. Zahlreiche Leserbriefe zeugen doch eigentlich von einer interessierten Mitgliedschaft! Wenn man sie jedoch dermassen „einschränkt“ oder ausgrenzt in den Möglichkeiten, sich wahrzunehmen und einzubringen, muss man sich nicht wundern, wenn sie weniger werden.…oder kritischer.
Nun würde ich keineswegs eine Lösung darin sehen, die derzeit Leitenden auszuwechseln und andere zu „installieren“ – die dann ihrerseits wieder, um handlungsfähig zu sein, Andersdenkende sich vom Halse halten müssen, die aus der Flut von Emails ihre Auswahl treffen und die Mehrzahl unbeantwortet lassen – vor allem die unangenehmen Nachfragen – und ihre Entscheidungen in ihrem Kreise ohne Transparenz hinter verschlossenen Türen fällen. – Dann dienen Mitglieder-Abende dem Ziel, dass alle mal „Dampf ablassen können, damit man anschliessend in Ruhe weiterarbeiten kann“ (Zitat eines Vorstandsmitgliedes vor Jahren). – Und ehrlich gesagt – ich kann es sogar ein wenig nachvollziehen. Nur glaube ich nicht, dass eine derart geleitete Gesellschaft zukunftsfähig oder gar ein Kulturfaktor werden kann, und erst recht nicht eine wahrhaft anthroposophische Gesellschaft sein KANN!
Nein, ich sehe vielmehr das Problem in den Strukturen unserer AAG selbst. Und damit in einem viel grösseren Problem, dass nur langfristig zu lösen sein würde! Solange wir nicht alle vollkommen selbstlos und geläutert sind, brauchen wir Sozialformen, welche diesen unseren Einseitigkeiten Rechnung tragen. Es kann kein Mensch, auch nicht eine kleine Gruppe, die Rolle Rudolf Steiners übernehmen und eine Gesellschaft mit über 40.000 Mitgliedern in einer zeitgemässen Form leiten. Nur er konnte als Eingeweihter die Menschen wahrhaft erkennen, ihr tiefstes Wesen, ihre karmischen Voraussetzungen, ihre Fähigkeiten und Zielrichtungen. In einer modernen anthroposophischen Gesellschaft müsste eine Fähigkeiten-Hierarchie entstehen, damit jeder seine Aufgabe seinen Kräften und Fähigkeiten gemäss erfüllen kann. (Wege hierfür wären gemeinsam zu suchen!) Stattdessen haben wir ein – Verzeihung – Cliquenwesen! Wo wie in der Politik Ämter vergeben werden nach persönlicher Nähe und Bekanntschaft, Sympathie und karmischer Verbundenheit, nicht jedoch unbedingt nach Fähigkeiten, denn man kann ja gar nicht alle Fähigen und Geeigneten erkennen – allein schon auf Grund der Anzahl und – der karmisch gefärbten Brille oder Blindheit. Unsere Gesellschaft müsste wenigstens im Sinne des dreigliedrigen Menschen ein freies Geisteslegen ermöglichen und die Gleichheit im Rechtlich-Sozialen, was sich z.B. darin ausdrücken würde, dass inhaltliche Darstellungen von Mitgliedern in einer Wochenschrift Raum gegeben wird und auch auf einer Generalversammlung die Redezeit nicht nur für Vorstände und Leitende relativ unbegrenzt ist. – Natürlich müsste man machbare Formen finden! Und doch – unter Rudolf Steiners Leitung war es noch so: Die GV dauerte so lange, wie es notwendig war, um allen Gehör zu schenken und Konflikte zu lösen,… nämlich über eine Woche lang. (Klingt natürlich völlig utopisch, macht aber etwas deutlich!)
Ungesunde soziale Gestaltungen müssen zu Unfrieden führen – und schwächen doch letztlich dadurch alle, vor allem die AAG und die Anthroposophie, welche in ihr leben können sollte! – Die Sozialgestaltung ist die höchste der sieben Künste, Rudolf Steiner nennt sie die königliche Kunst. Der Tempelbau im Sozialen ist die wahre Aufgabe der Anthroposophie – und der AAG?
Wenn wir uns am Montag wiedersehen, stellt sich die Frage, wie kann es zu einem wirklich fruchtbaren Dialog kommen? Nur in einem ergebnisoffenen Gespräch und gemeinsamer Suche nach dem richtigen Weg.
Wir haben (bisher) nur diese eine Gesellschaft, aber sie ist ein gemischter König. Das dient nur den Gegenmächten. Endlich beginnen, sie zu heilen und verwandeln würde ich als die wichtigste Aufgabe nach 3 x 33 Jahren Brand und Weihnachtstagung sehen!
Eva Lohmann-Heck, 30.März 2022
von Thomas Heck | Mrz 29, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Vorbemerkung
Ursprünglich waren für diesen Gedenktag Beiträge vorgesehen, die nun aufgrund der aktuellen Themen vor der Generalversammlung warten müssen. Durchaus passend zu diesem 97. Todestag erscheint es jedoch, wenn, ausgehend von einem Rückblick auf Rudolf Steiners damaliges Bemühen um die Konsolidierung der Gesellschaft, die sich aktuell zuspitzende Situation der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in den Blick genommen wird.
Dazu eine persönliche Bemerkung vorab: Es lag überhaupt nicht in meiner Absicht, mich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der diesjährigen Generalversammlung zu engagieren. Zu deutlich schienen mir die beiden vorherigen GVs von Desinteresse seitens der Mitgliedschaft geprägt. Trotz der neu gegebenen Möglichkeit der weltweiten Online-Teilnahme, wurde diese kaum genutzt: Im letzten Jahr nahmen von den mehr als 40.000 Mitgliedern gerade einmal 350 aus 45 Ländern an dem Livestream und an der Abstimmung teil. Mit einer derartig geringen Teilnahme hatte wohl kaum jemand gerechnet. 350 Teilnehmer an einer GV wären auch für eine Präsens-GV in Dornach nicht viel. Man kann gespannt sein, wie es dieses Jahr sein wird.
So war die deutliche Resonanz aus der Mitgliedschaft auf die Einladung zu der Informationsveranstaltung zur Weleda am 17. März 2022 überraschend gross, vermutlich auch für die Gesellschaftsleitung (siehe Rundbrief 34 und 35[1]). Es geht hier um das Schicksal der Weleda, die untrennbar verbunden ist mit der Anthroposophischen Medizin, zumindest ursprünglich. So wird die unklare Kommunikation bzgl. nicht mitgeteilter wesentlicher Veränderungen im Unternehmenszweck und der Absicht, die Weleda-Anteile an eine noch nicht existierende Stiftung zu übertragen (und damit zu verkaufen, inzwischen wird auch von «neu gliedern» gesprochen) offensichtlich von vielen Mitgliedern nicht akzeptiert. So lohnt es, hier Licht ins Dunkel zu bringen, endlich zu erfahren, was wirklich beabsichtigt ist und dem ggf. Einhalt zu gebieten – im Interesse der ursprünglichen Intentionen der Weleda. Genau dafür trägt die Mitgliedschaft einen wesentlichen Anteil der Verantwortung, was offensichtlich auch erlebt wird. So hat sich aus der Sache und der Situation ergeben, dass jetzt ein Engagement sinnvoll erscheint. Zur weiteren Entwicklung, neuen Informationen und einem möglichen Vorgehen wird weiter unten ausgeführt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der ebenfalls wie im Weleda-Zusammenhang, ausgerechnet jetzt, 3 x 33 Jahre nach dem Schicksalsjahr 1923 auftaucht, ist die Absicht des Vorstandes, die Zentralisierung der Gesellschaftsleitung weiter zu verstärken, in dem die Konferenz der Generalsekretäre und Landesvertreter zu einem statuarischen Gesellschaftsorgan erhoben werden soll. Auch in unserer Gesellschaft ist damit eine zunehmende «Aristokratisierung» zu beobachten.
Mit diesen Themen kann angeknüpft werden an Rudolf Steiners damalige Versuche, der Anthroposophischen Gesellschaft, insbesondere der Leitung, den Spiegel vorzuhalten und die damals entstandene problematische Entwicklungsrichtung zu korrigieren. Insofern scheint es angemessen nach jetzt 99 Jahren die Frage zu stellen, ob die aktuell eingeschlagene Entwicklungsrichtung, die aus dem Handeln der Leitung deutlich wird, einer Korrektur bedarf. Eine solche Korrektur – wenn sie denn notwendig ist – kann heute nur aus der Mitgliedschaft geleistet werden.
3 x 33 Jahre nach dem Schicksalsjahr 1923 – zur Lage der Gesellschaft
Nach dem Gesetz der 33 Jahre korrespondiert das aktuelle Jahr 2022 mit den Jahren 1989 und 1923, dem Schicksalsjahr sowohl der Anthroposophischen Gesellschaft als auch Mitteleuropas (und damit der ganzen Welt). Von diesen und zwei weiteren Zeitreihen (1902 und 1913) handelten die vorherigen Beiträge «100 Jahre Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft»[2] und «… am Grabe aller Zivilisation?»[3]. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der an der Weihnachtstagung gegründeten Gesellschaft nicht um die heutige Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft handelt!
Unübersehbar leben wir in einer Zeit der Zentralisierung, in der weltweit die Macht von den nationalen Regierungen auf supranationale Organisationen verlagert wird, welche von relativ kleinen, demokratisch nicht legitimierten Gruppen beherrscht werden. Es ist weltweit zu erleben, was Rudolf Steiner bereits 1905 vorausgesagt hatte, «denn der Gang der Entwickelung ist nicht der, dass wir demokratischer werden, sondern dass wir brutal aristokratisch werden.»[4] Und kann es einen Zweifel an der Aktualität folgender Aussage geben? «Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit den Mitteln der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen gehören alle diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande ist, durch Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren.»[5]Der schon seit Längerem erkennbare Entdemokratisierungsprozess spitzt sich immer weiter zu, immer unverhohlener und offensiver wird diese Aristokratisierung betrieben und in den Auswirkungen tatsächlich immer brutaler. (Man denke nur an die Pläne des «Great Reset», die Impfpflicht und die Einschränkungen der Grundrechte.) Nicht übersehen sollten wir, dass all dieses Geschehen auch okkulte Hintergründe hat und wir es bei den uns bekannten Protagonisten zu allermeist mit Marionetten zu tun haben, «Hampelmänner»[6] hat Rudolf Steiner diese genannt, Werkzeuge derer, die wirklich dieses öffentliche Geschehen steuern. Und wir sollten uns «nicht durch die schwarze Magie des Journalismus herumkriegen»[7] lassen und gutgläubig meinen, die da oben wollen nur unser Bestes.
Und machen wir uns nicht vor: Auch in unserer Gesellschaft gibt es diese Machtkonzentrationen: Die Entwicklung der Statuten seit 1925 sprechen eine deutliche Sprache: z.B. wurde 1935 das von Rudolf Steiner als «Inzucht»[8] bezeichnete Kooptionsprinzip eingeführt. Seit 1975 ist das Dogma des sogenannten Initiativvorstandes in den Statuten festgeschrieben. 1999 fand der erste Versuch[9] statt, das Antragsrecht der Mitglieder massiv einzuschränken, im Weiteren 2001 und dann 2002.[10] Mit der Einführung der Amtszeitbeschränkung im Jahr 2011 wurden besonders hehre Ziele formuliert, obwohl in Wirklichkeit etwas ganz anderes verfolgt wurde. So sollten angeblich «… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden» und «Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden.» Und weiter: «Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht». Diese Äusserungen erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Tatsächlich war es ein geradezu taktisches Lügengebäude, denn Paul Mackay gestand 2019 öffentlich ein, dass die Einführung [der Amtszeitbeschränkung] 2011 lediglich eine (mögliche Über-)Reaktion auf den damaligen [2011] Abwahlantrag gewesen sei! Er meinte, eine regelmässige Besinnung auf die Vorstandstätigkeit sei schon notwendig, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich![11]
Nur ein Jahr später (2012) wurden Vorstandsaufgaben an die neu gebildete «Goetheanum-Leitung» übertragen, deren Bildung und Organisation weder eine statuarische noch eine gesetzliche Grundlage haben. Damit ist ein Gesellschaftsorgan entstanden, welches weder durch die Mitgliedschaft legitimiert noch dieser gegenüber rechenschaftspflichtig ist. So finden wir auch innerhalb unserer Gesellschaft Entwicklungstendenzen wieder, die wir in der Weltpolitik beobachten können: eine deutliche Machtkonzentration, die nun an der diesjährigen Generalversammlung noch verstärkt werden soll, indem die Konferenz der Landesvertreter und Generalsekretäre in den Stand eines statuarischen Organs erhoben werden sollen. Wieviel Leitungsorgane braucht diese Gesellschaft denn noch? Und Inzucht[12] herrscht in diesen Kreisen allemal: Niemand wird gegen den Willen des Vorstandes Generalsekretär oder Landesvertreter. Und seit Jahren verständigt man sich bereits auf dieser Ebene, bevor man irgendetwas an die Mitglieder heranträgt. Aber wehe denjenigen, die aus diesen Konsens-Kreisen ausscheren und sich eine eigene Meinung erlauben. Davon konnte der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz ein Lied singen, der sich 2018 intern, nicht einmal öffentlich, gegen eine Amtszeitverlängerung von Paul Mackay und Bodo von Plato ausgesprochen hatte. Intern im Kreis der Leitenden in der AAG brach eine regelrechte Hexenjagt über sie herein.[13]
Noch ein Leitungsorgan?
Wozu soll nun dieses neue Organ gut sein? Wäre es nicht zeitgemässer zu fragen, wie die Mitgliedschaft tatsächlich einbezogen werden kann? Stattdessen gab es 2018 erneut Ansätze, sowohl das Verfahren von Mitgliederanträgen zu modifizieren als auch Ablehnungen von Amtszeitverlängerungen zu verhindern bzw. diese zu erschweren.[14] Damals war von «Partizipation» der Mitglieder die Rede, das Gegenteil wird und wurde jedoch betrieben. Gilt nicht auch für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, die ja Musterverhältnisse sein sollten, was auch im Grossen gilt?
«Wir stehen heute auf einem anderen Boden, und heute sind eben die Menschen nicht so, dass sie sich von kleinen Gruppen dasjenige diktieren lassen wollen, was sie zu tun haben … Heute ist die Zeit, in der man lernen muss den Unterschied zwischen herrschen und regieren. … Herrschen muss heute das Volk, eine Regierung darf nur regieren. Das ist es, worauf es ankommt. Und damit ist auch gegeben, dass in einem gesunden Sinne heute die Demokratie notwendig ist. Deshalb habe ich auch keine Hoffnung, dass man mit den schönsten Ideen etwas erreichen kann, wenn man sie durch kleine Gruppen verwirklichen will und wenn man nicht getragen wird von der Erkenntnis und Einsicht der wirklichen Majorität der Bevölkerung. Die wichtigste Aufgabe heute ist, die große Mehrheit der Bevölkerung für das zu gewinnen, was man als Möglichkeit zur Veränderung erkannt hat. So stehen wir heute vor der Notwendigkeit, für das, was zuletzt wirklich an wahrer Sozialisierung erreicht werden wird, in demokratischer Weise die Mehrheit der Bevölkerung zu haben.»[15]
Mit recht drastischen Formulierungen hielt Rudolf Steiner 1923 insbesondere den in konkreten Aufgaben und leitenden Funktionen stehenden Mitgliedern den Spiegel vor, vergegenwärtigte die Situation und den Zustand der Gesellschaft. Diese stünde vor dem Zerfall, sie sei ein Schemen, alles was nicht verstanden wurde, sei sofort getan worden bzw. geschah das Gegenteil von dem, was er sagte. Seit 1914, verstärkt aber im Jahr 1923 sprach Rudolf Steiner von einer «inneren Opposition» und bezeichnete die Gesellschaft als «ahrimanisch durchlöchert»[16]. Das bedeutete ja nichts anderes, als dass die gegnerischen Impulse innerhalb der Gesellschaft wirkten, die Widersacher, welche sich für ihr Wirken der Menschen bedienen.
Und heute? Ist unsere Gesellschaft auch «ahrimanisch durchlöchert»? Gibt es auch heute eine «innere Opposition» in der Gesellschaft? Ein Wirken gegen die Intentionen Rudolf Steiners? Diese Frage muss gestellt werden!
Verantwortung der Mitgliedschaft
Die AAG ist ein Verein nach Schweizer Recht. Damit ist das oberste Organ, der Souverän, die Mitgliedschaft – vertreten durch das Organ der Generalversammlung. Und damit trägt auch die Mitgliedschaft in letzter Konsequenz die Verantwortung für das, was in der Gesellschaft geschieht, wie die Gesellschaft durch die Leitung repräsentiert wird und auch für die Folgen, die sich ergeben können, wenn der Vorstand nicht im Sinne der Gesellschaft handelt, nicht die Interessen der Gesellschaft vertritt. All die Verhältnisse, die wir heute in der Gesellschaft haben, können nur so sein, wie sie sind, da sie von der Mitgliedschaft mehrheitlich entweder genau so gewollt sind – oder eben toleriert werden.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit der Goetheanum-Leitung ein Leitungs-Organ in der Gesellschaft geschaffen wurde, welches nicht durch die Mitgliedschaft legitimiert wurde und keine Rechenschaft ablegen muss. Das ist ein im Grunde unhaltbarer Zustand und wäre unter Rudolf Steiner kaum möglich gewesen. Und so stellt sich die Frage, ob es denn nicht höchste Zeit wäre, dass auch die Sektionsleitungen Rechenschaft ablegen und sich der Bestätigung durch die Mitgliedschaft stellen müssten?
Entsprechend dem oben wiedergegebenen Zitat Rudolf Steiners müsste vielmehr ein Mitgliederorgan entstehen bzw. entwickelt werden, frei aus der Mitgliedschaft, nicht dominiert durch die Gesellschaftsleitung. Und diesem Organ wären dann von der GV entsprechende Kompetenzen zu übertragen, um ein Zusammenwirken mit den Leitungsorganen auf Augenhöhe zu ermöglichen. Dass ein solches Organ entsteht, liegt naturgemäss nicht im Interesse des Vorstandes. Nur aus der Mitgliedschaft könnte ein solches Organ entstehen. Allerdings wird auch das erst möglich sein, bzw. können entsprechende Initiativen entstehen, wenn die Mitgliedschaft Bereitschaft gezeigt hat, ihre Verantwortung zu übernehmen.
Eine Empfehlung oder gar ein Aufruf, dem Antrag des Vorstandes für das geplante Organ der Generalsekretäre und Landesvertreter zu- oder nicht zuzustimmen, erfolgt hiermit ausdrücklich nicht. Jeder möge sich selber ein Urteil bilden – möglichst vor der GV.
Das Gleiche gilt für die Fragen zur Weleda. Auch hier trägt die Mitgliedschaft die Letztverantwortung dafür, welche Entwicklungsrichtung eingeschlagen werden soll. Hier gilt im Besonderen: Eine sachgemässe Urteilsbildung allein an der GV ist kaum möglich.
Die Lage der Gesellschaft mag aussichtslos erscheinen, das war 1923 für Rudolf Steiner nicht anders. Er hat es trotzdem versucht.
Zur Weleda
Das Wesentliche ist bereits beschrieben worden, nachzutragen ist einerseits, mit welcher Konsequenz die Änderung des Unternehmenszweckes erfolgt ist. Das wird aus der Begründung des nachfolgenden Antragsvorschlags deutlich.
Leider wurden die an Justus Wittich gestellten Nachfragen zu seinen Äusserungen anlässlich der Informationsveranstaltung am 17. März 2022 bisher nicht beantwortet (Stand 28. März 2022). Deutlich ist, dass man auch am Goetheanum mit zahlreichen kritischen Reaktionen beschäftigt ist.
Antrag zum Tagesordnungspunkt «Entlastung des Vorstandes» (Entwurf)
Sachverhalt und Begründung des Antrages
Es gehört zur Aufgabe des Vorstandes der AAG, die Gesellschaft nach aussen zu repräsentieren und, im Rahmen der ihm übertragenen Kompetenzen, deren Interessen zu vertreten. Weiterhin obliegt ihm lt. Statuten u.a. die Geschäftsführung der Gesellschaft. Bestandteil der Gesellschaft ist die Freie Hochschule mit den verschiedenen Fachsektionen. Diese wird u.a. mit Mitteln der AAG finanziert.
Die laufende Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb, freien Spenden und Legaten. Zu den Einnahmen gehören auch die Zuwendungen von der Weleda, in Form von Spenden und Dividenden.
Die AAG ist Hauptaktionärin der Weleda AG und wird in deren Gremien (Verwaltungsrat und Generalversammlung) durch den Vorstand bzw. durch eine von diesem benannte Person vertreten.
Mit Bezug auf die Weleda AG liegt es im Interesse der AAG, dass diese insbesondere für die Anthroposophische Medizin geeignete und benötigte Heil- und Pflegemittel herstellt und vertreibt. (Streng zu unterscheiden sind Pflegemittel und Kosmetika. Die Herstellung und der Vertrieb letzterer liegt nicht im primären Interesse.) Weiterhin liegt es im Interesse der AAG, von der Weleda jährlich zusätzlich zu den Dividenden einen Beitrag zur Finanzierung der Gesellschafts- und Hochschulaufgaben zu erhalten. Dies erfolgt in Form einer Spende. Diese Spendenpraxis ist durch den Unternehmenszweck legitimiert (§2 der Weleda-Statuten[17]).
Im Jahr 2020 wurde der Unternehmenszweck erweitert und die Statuten entsprechend ergänzt. Dort wurde ergänzt (§2, Abs. 4): «Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen.»
Ebenfalls im Jahr 2020 wurde durch eine Pressemitteilung[18] veröffentlicht und mitgeteilt, dass die Weleda ab 2022 jährlich 1% des Umsatzes für Klimaschutz und den Erhalt der Biodiversität spenden wird. Dieser Betrag entspricht in etwa dem Dreifachen dessen, was jährlich an die AAG gespendet wird. Konkret sind für das Jahr 2022 4,6 Mio. CHF vorgesehen. Laut einer aktuellen Mitteilung an die Aktionäre sollen schwerpunktmässig die Bereiche Biodiversität, Bodengesundheit, Klimaschutz, nachhaltigere Verpackungen sowie gute Unternehmensführung (Governance) und Gemeinwohl gefördert werden. Inwieweit es sich dabei um anthroposophische Projekte handelt, ist nicht erkennbar und wird nicht erwähnt.
Bemerkenswert ist, dass auch im §20 (Aufgaben des Verwaltungsrates) eine Ergänzung vorgenommen wurde. Es wurde ergänzt:
«Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt der Verwaltungsrat (i) die kurz- und langfristigen Interessen der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer, (ii) den Zweck der Gesellschaft eine erhebliche positive Auswirkung auf das Gemeinwohl und die Umwelt zu erzielen, sowie (iii) die Auswirkungen ihres Handelns gegenüber den relevanten Interessengruppen unter anderem: ihren Mitarbeitenden, ihren Kunden, den Regionen und Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, und der Umwelt.» Auffällig ist, dass bei der Entscheidungsfindung insbesondere die Interessen der Anthroposophischen Medizin und die ideellen und finanziellen Interessen der anthroposophisch orientierten Hauptaktionäre (AAG und Klinik Arlesheim) nicht einmal erwähnt werden.
Es ist undeutlich, ob und inwieweit bei den zukünftigen Spenden in Höhe 1% des Umsatzes anthroposophische Institutionen und Initiativen überhaupt berücksichtigt werden. Auch die für 2022 konkret genannten Bereiche geben darüber keinen Aufschluss. Es kann der Eindruck entstehen, dass anthroposophische Projekte nicht mehr priorisiert werden und es stellt sich die Frage, ob dies im ideellen bzw. finanziellen Interesse der Hauptaktionärin AAG liegt.
Da eine Zweckänderung der Weleda-Statuten nur mit einer 2/3 Mehrheit möglich ist, hat der Vertreter der AAG – Paul Mackay in Vertretung und Verantwortung des Vorstands – dieser Änderung zugestimmt.
Einerseits liegt damit eindeutig eine Kompetenzüberschreitung vor, denn eine derartige Änderung des Unternehmenszweckes der Weleda mit möglicherweise gravierenden Folgen für den Finanzhaushalt der AAG liegt nicht im Bereich einer normalen und üblichen Geschäftsführung eines Vereins. Derartige Kompetenzen wurden dem Vorstand nicht übertragen!
Nochmals: Es ist also festzustellen, dass der Unternehmenszweck der Weleda geändert wurde, dieser Änderung durch den Vertreter des Vorstandes der AAG zugestimmt wurde, obwohl ein dafür notwendiger GV-Beschluss der AAG oder eine entsprechende Kompetenzübertragung nicht vorlagen.
Gegenüber der Aussenwelt ist die Veränderung der Statuten rechtswirksam. Die Verantwortung liegt beim Vorstand der AAG, auch wenn dieser nur mittelbar durch einen beauftragten Vertreter (Paul Mackay) gehandelt hat. Unklar ist derzeit, ob der Vorstand rechtlich für sein Vorgehen belangt werden könnte, da eindeutig und erkennbar nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt wurde.
Da die Spendenpraxis erst in diesem Jahr (2022) beginnen soll, ist ein möglicher finanzieller Schaden eventuell noch nicht eigetreten.
Da diese wesentliche und nicht im Interesse der AAG liegende Veränderung des Unternehmenszweckes der Weleda AG der Mitgliedschaft nicht mitgeteilt und keine Rechenschaft darüber abgelegt wurde, gilt die Vorstandsentlastung aus dem Jahr 2021 für diesen Vorgang nicht. (Grundsätzlich gelten Entlastungen nur für Handlungen, über die berichtet und Rechenschaft abgelegt wurde.)
Eine Entlastung des Vorstandes für dieses Vorgehen erscheint nicht sinnvoll. Zudem sollten die Veränderungen des Unternehmenszweckes der Weleda AG nach Möglichkeit wieder rückgängig gemacht werden. Daher sind folgende Beschlüsse (im Sinne einzelner Anträge) erforderlich:
Antrag A
Die GV möge beschliessen:
Eine Entlastung des Vorstandes für alle Tätigkeiten und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Rolle als Hauptaktionär der Weleda AG in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen, wird zurückgestellt, bis ein lückenloser Rechenschaftsbericht über diese Vorgänge vorliegt bzw. die genannten Statutenänderungen der Weleda AG rückgängig gemacht wurden.
Antrag B
Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, für die diesjährige Generalversammlung der Weleda AG am 20.05.2022 in Dornach einen Antrag zu stellen, der darauf hinzielt, die Erweiterung des Unternehmenszweckes von 2020 wieder vollständig rückgängig zu machen (§2, Abs. 4 und §20 neuer Abs. 8 sind ersatzlos zu streichen).
Antrag C
Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, unverzüglich im Verwaltungsrat darauf hinzuwirken, dass die für 2022 anvisierte Spendenpraxis von 1% an Umwelt und Klima nicht weiter umgesetzt wird. Die Geschäftsleitung der Weleda AG ist unmittelbar nach der Beschlussfassung (nach der GV) über diesen Beschluss zu informieren.
[1] https://www.wtg-99.com/Rundbrief_34 und https://www.wtg-99.com/Rundbrief_35.
[2] ENB Nr. 1/2022.
[3] ENB Nr. 6/2022.
[4] GA 93, S. 126.
[5] Manuskript zu den Hintergründen des Kriegsgeschehens teilweise veröffentlicht unter dem Titel «Der Kampf um den russischen Kulturkeim» in: Der Europäer, 3. Jg. Nr. 5 (März 1999), S. 3 (Manuskript Archiv Perseus Verlag), hier wiedergegen nach GA 173c.
[6] z.B. GA 173a, S. 141.
[7] GA 173c, S. 55.
[8] GA 259, S. 226.
[9] Siehe: https://wtg-99.com/papierkorbentwurf.
[10] https://wtg-99.com/Entwicklung_Antragswesen.
[11] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 28.03.2022).
[12] Kooption wurde von Rudolf Steiner so bezeichnet: GA 259, S. 226.
[13] Siehe hierzu: https://wtg-99.com/letter-to-sijmons.
[14] Anthroposophie weltweit Nr. 12/18.
[15] GA 331, S.68f.
[16] GA 259, S. 302.
[17] https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/ch-de/aktien/statuten_05062020.pdf.
[18] https://www.presseportal.de/pm/25239/4913584.
von Thomas Heck | Mrz 24, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Wie bereits berichtet[1] soll die Mitgliedschaft der AAG an der Generalversammlung 2022 dem Vorhaben des Vorstandes zustimmen, die seit knapp 100 Jahren bestehende Beteiligung an der Weleda an eine noch unbekannte – bzw. noch nicht bestehende – Stiftung zu übertragen. Da dies zum Nennwert (d.h. zum Ursprungswert) erfolgen soll und damit auch eine Gegenleistung[2] erfolgen wird, kann dieser Vorgang auch als Verkauf bezeichnet werden.
Es handelt sich dabei um ein ähnliches Vorhaben wie schon 2009[3], welches durch Einsprachen von Mitgliedern verhindert wurde. Nun taucht es wieder auf, ohne dass inzwischen ein klares oder gar konkretes Konzept entwickelt wurde.
All dies geschieht nun ausgerechnet 3 x 33 Jahre nachdem die Weleda in den Besitz der Gesellschaft kam und damit gleichzeitig 3 x 33 Jahre nach der Weihnachtstagung. Die Weleda ist in ihren Ursprüngen und Urintentionen ganz eng mit dem anthroposophischen Heilimpuls verbunden. Gerade dem Bereich der Medizin und des Heilwesens mass Rudolf Steiner grosse Bedeutung zu: An der Weihnachtstagung brachte er dies sowohl im Eröffnungs- als auch im Abschlussvortrag sehr deutlich zum Ausdruck. Es war und ist ein stark umkämpftes Gebiet, dies wurde insbesondere in den letzten zwei Jahren mehr als deutlich.
Eine Richtigstellung vorab
In dem Beitrag „Zu den aktuellen Absichten des Goetheanums mit der Weleda“, der in „Ein Nachrichtenblatt“ Nr. 6/2022 sowie in dem Rundbrief Nr. 34[4] in „Was in unserer Gesellschaft noch vorgeht“ erschienen ist, hiess es, dass der Vorstand auch ohne einen Generalversammlungsbeschluss über die Weleda-Beteiligungen verfügen könne. Das Gegenteil ist der Fall, eine Zustimmung der Generalversammlung ist zwingend notwendig, da es sich um eine Vermögensverfügung handelt, die weit über den Rahmen einer normalen Geschäftsführung hinausgeht. Hinzu kommt, dass die Generalversammlung der AAG am 27. März 2010 folgendem Antrag zugestimmt hatte: «Antragsteller und Vorstand beantragen, dass jegliche Verfügung über Stimmrechte und/oder die stimmberechtigten Aktien der Weleda AG der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft bedarf.»
Ein Compliance-Problem?
An der von Mitgliedern zu diesem Vorhaben initiierten Informationsveranstaltung vom 17. März 2022 in Arlesheim nahm auch Justus Wittich teil. Aus seinen Ausführungen wurde deutlich, dass im Vordergrund dieses Vorhabens steht, die jährlich Spende von 1,6 Mio. CHF an die AAG sicherzustellen. Theoretisch könne sich ein sogenanntes Compliance-Problem daraus ergeben, dass die AAG als einer der Hauptaktionäre eine (gewinnmindernde) Spende erhalte. Dadurch könnte sich einer der übrigen Dividendenempfänger benachteiligt fühlen und auf Gleichstellung klagen. Möglicherweise könnte in einem solchen Fall die Weleda zumindest vorübergehend diese Spende an die AAG nicht auszahlen und so entstünde im Haushalt der AAG ein Problem. Allerdings, so fügte Justus Wittich hinzu, sei das aktuelle Vorgehen mit grosser Wahrscheinlichkeit rechtssicher in Ordnung und würde daher auch einer gerichtlichen Prüfung standhalten.
Dieses somit theoretische und wahrscheinlich gar nicht vorhandene Problem solle nun in der Weise gelöst werden, dass die Aktien und Partizipationsscheine zum Nennwert[5] an eine (unbekannte bzw. noch zu gründende) Stiftung übertragen werden. Die AAG wäre dann ihrer Doppelrolle als Hauptaktionärin und Spendenempfängerin enthoben. Vollkommen unklar ist, wie dann die Wächterfunktion der AAG erhalten bleiben soll, in jedem Fall bestünde bei einem solchen Vorgehen endgültig und unwiederbringlich keine Möglichkeit mehr, im Falle eines Falles seitens der Mitgliedschaft Einfluss z.B. auf die Entwicklungsrichtung der Weleda zu nehmen, im Sinne einer Notbremse.
Mit Blick auf die Statuten der Weleda AG scheint dieses Compliance-Problem wirklich ein nur theoretisches zu sein, denn es ist
- einerseits klar geregelt, dass es zum Unternehmenszweck gehört, anthroposophische Institutionen zu fördern (§ 2, Satz 3) und
- andererseits die Höhe der Dividende nicht abhängig davon ist, ob oder inwieweit Spenden an steuerlich anerkannte gemeinnützige Institutionen geleistet werden (§ 29).
Diese Regelungen sind eindeutig, jeder Aktionär oder Partizipationsscheininhaber kann sowohl die Statuten als auch die jahrzehntelange Praxis kennen und es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass eine Klage auf Gleichstellung Chancen auf Erfolg hätte. Hier sollte aber noch eine anwaltliche Einschätzung eingeholt werden, sofern eine solche nicht bereits am Goetheanum vorliegt und zur Kenntnis gegeben werden kann. Eine entsprechende Anfrage bei Justus Wittich ist erfolgt (siehe Anhang, am 21. März 2022 angefragt, aktuell[6] unbeantwortet).
So stellt sich die Frage, ob es wirklich angemessen ist, einen derartig schwerwiegenden, lt. Justus Wittich auch sehr teuren und vor allem endgültigen Schritt zu gehen.
Hinzu kommt, dass die Absicht dieser Gestaltung für jedermann erkennbar ist: so blieben die Spenden an die AAG auch weiterhin gewinnmindernd. Ob dies als Gestaltungsmissbrauch ausgelegt werden könnte und somit überhaupt eine rechtssicherere Situation als aktuell entstünde, müsste überprüft werden. Es ist also fraglich, ob die gewünschte Sicherheit überhaupt eintritt oder ob sich der Vorgang im Nachhinein als sehr viel schwerwiegenderer Fehler herausstellen kann, als der damalige Verkauf der Partizipationsscheine an eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Dass dies ein gravierender Fehler war, räumte Justus Wittich ganz klar ein.
Worüber reden wir eigentlich?
Die Beteiligung an der Weleda steht in der Bilanz der AAG mit ca. 3,1 Mio. CHF zu Buche. Dabei handelt es sich um den Nennwert oder den Nominalwert. Das ist der Wert, den die Wertpapiere zu dem Zeitpunkt hatten, als diese erstmals ausgegeben wurden. Der Wert der Partizipationsscheine hat sich seitdem verzehnfacht[7] und auch der Wert der Aktien dürfte heute bei dem 10-fachen liegen. Demnach läge der aktuelle Zeitwert der AAG-Beteiligung bei ca. 30 Mio. CHF. Wäre die Weleda ein ganz normales Unternehmen und die Aktien frei handelbar, wäre der Wert vermutlich noch deutlich höher, wie hoch, ist schwer einzuschätzen.
Damit kein Missverständnis entsteht: Es soll hiermit keineswegs propagiert werden, die Wertpapiere zu Geld zu machen oder den Aktienbesitz als konventionelle Wertanlage zu betrachten. Wir sollten uns aber darüber klar sein, dass der bilanzierte Wert von ca. 3,1 Mio. CHF bei weitem nicht repräsentiert, worüber jetzt verhandelt wird. Ebenso wenig wie etliche Liegenschaften, die im Besitz der AAG sind, deren Zeitwert im Millionenbereich liegt und die mit lediglich einem Franken bewertet in der Bilanz stehen.
Umgang mit Vereinsvermögen
An dieser Stelle ist es notwendig darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit Vereinsvermögen nicht immer, sagen wir, glücklich war. Zu erinnern ist an die Vorgänge, die im Zusammenhang mit dem Wirken des damaligen Schatzmeisters Dieter Pommerening in der AGiD entstanden waren, in deren Folge Millionenverluste eintraten und die deutsche Landesgesellschaft in Gefahr war, die steuerliche Gemeinnützigkeit zu verlieren. Immer wieder müssen Haushaltslücken der AAG durch Liegenschaftsverkäufe und aus Erlösen von Legaten gedeckt werden. Das selbst formulierte Ziel der unumgänglichen Sanierung der Goetheanum-Finanzen[8] (siehe hier) konnte nicht erreicht werden, so ist nachvollziehbar, dass der Schatzmeister eigentlich mehr als Defizitmeister fungieren muss und ihn permanent Sorgen plagen, mit welchen Mitteln die Gehälter und die sonstigen Ausgaben bezahlt werden sollen. Keine beneidenswerte Aufgabe. Es kann aber nicht sein, dass das Weleda-Vermögen aus Gründen der Defizitdeckung ausgelagert werden soll.
Verlagerung des Unternehmenszweckes
Die ursprünglichen Intentionen zur Gründung der Weleda-Betriebe (Chemische Werke Gmünd und die Internationalen Laboratorien AG in Arlesheim) lagen eindeutig in der Entwicklung anthroposophischer Medikamente und Pflegeprodukte. Der Kosmetikbereich hat sich erst im Laufe der Zeit aus der Weiterentwicklung der medizinischen Pflegeprodukte entwickelt. Heute sei die Weleda AG der weltgrösste Hersteller von Naturkosmetik. Mit ca. 80% des Gesamt-Umsatzes liegt hier heute das Hauptgeschäft. Insofern hat sich der Betrieb von den ursprünglichen Intentionen entfernt und es befremdet, wenn man hört, dass die aufgrund aufwendiger Herstellungs- und Zulassungsanforderungen im Medizinbereich entstandenen finanziellen Defizite nicht mehr durch den sehr profitablen Bereich der Naturkosmetik ausgeglichen werden sollen und stattdessen eine massive Streichung der zugelassenen Heilmittel bereits erfolgt ist. Da eine Neuzulassung unter heutigen Bedingungen unbezahlbar wäre, sind diese Heilmittel – es wird davon gesprochen, dass von ursprünglich 2.500 nur noch ca. 750 übrig sein sollen – für die Anwendung möglichweise endgültig verloren. Inwieweit die Gründung der Weleda Healthcare AG[9] eine Lösung dieses Problems darstellen wird, konnte noch nicht geklärt werden.
Ist es Aufgabe der Weleda, Umwelt und Gemeinwohl zu fördern?
Die Weleda ist offensichtlich derartig profitabel, dass der Unternehmenszweck ergänzt wurde, damit auch eine Förderung des Gemeinwohls und der Umwelt möglich wird. Damit können keine anthroposophischen Institutionen gemeint sein, denn für deren Förderung wäre eine Erweiterung des Unternehmenszweckes nicht erforderlich gewesen.
So wurde Unternehmenszweck (§2 der Weleda-Statuten) wie folgt ergänzt:
„Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl und die Umwelt zu erzielen.“
In diesem Zusammenhang wurde lt. Pressemitteilung der Weleda angekündigt, zukünftig ab 2022 jährlich 1% des Umsatzes an Umweltorganisationen zu spenden. Im Vergleich zu der jährlichen Spende an die AAG in Höhe von ca. 1,6 Mio. CHF soll also in Zukunft jährlich zusätzlich(!) nahezu der dreifache Betrag, also ca. 4 Mio. CHF an Umwelt- und andere nichtanthroposophische Organisationen gespendet werden? Angesichts der Not bei den anthroposophischen Heilmitteln ist das nicht verständlich.
So stellt sich die Frage, wer für diese Entscheidung verantwortlich ist? Die Initiative dazu kann nur aus dem Verwaltungsrat gekommen bzw. von diesem gutgeheissen worden sein. Der Beschluss wurde an der Weleda-GV 2020[10] gefasst, in der die Klinik Arlesheim und die AAG durch die entsprechenden Verwaltungsräte vertreten sind und über eine 2/3-Mehrheit[11] verfügen. Der damalige Verwaltungsrat setzte sich aus folgenden Persönlichkeiten zusammen (Quelle: Geschäftsbericht der Weleda 2020 Seite 3, Hinweise kursiv in [] stammen nicht aus dem Geschäftsbericht):
- Paul Mackay, Verwaltungsratspräsident, [seit Januar 2020 Mitglied im Stiftungsrat WWF Deutschland und seit Juli 2020 Mitglied in dessen Finanzausschuss.
Quelle: https://www.wwf.de/ueber-uns/organisation/stiftungsrat-des-wwf/]. - Monique Bourquin, Verwaltungsrätin, seit 2019, [verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie und besetzte leitende Funktionen in Marketing und Sales in Unternehmen wie Knorr, Rivella und Mövenpick. Bei Unilever Schweiz war sie von 2008 bis 2012 Country Manager und bis 2016 CFO bei Unilever Deutschland für die DACH Region. Als Verwaltungsrätin begleitet sie neben der Kündig Gruppe Unternehmen wie Emmi AG, Kambly Holding SA und Weleda AG; sie ist im Stiftungsratsausschuss bei Swisscontact und Präsidentin von Promarca, dem Schweizerischen Markenartikelverband
Quelle: https://kuendig.com/governance/monique-bourquin/]. - Dr. Andreas Jäschke, Leiter Organisationskultur der Klinik Arlesheim.
- Ueli Hurter, Co-Leiter der Sektion Landwirtschaft am Goetheanum und Demeter-Landwirt.
- Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS-Gemeinschaftsbank.
- Elfi Seiler, Drogistin und Mitbesitzerin der St. Peter Apotheke in Zürich.
- Prof. Dr. Harald Matthes, Leitender Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin.
Nehmen wir also zu Kenntnis, dass unter dem Verwaltungsratspräsidenten Paul Mackay die Erweiterung des Unternehmenszweckes erfolgte, während dieser gleichzeitig Mitglied im Stiftungsrat des WWF war.
Zwischenfazit
Die Weleda AG stellt sich heute also als ein Unternehmen dar, welches seinen Hauptumsatz in einem Geschäftsbereich erzielt, der nicht den ursprünglichen Intentionen entspricht und der aufgrund seines Umfanges Umsätze in Bereichen tätigt, die ausserhalb des eigentlichen anthroposophischen Umfeldes liegen. Dies kommt vermutlich auch zunehmend (oder bereits überwiegend?) in der Besetzung zentraler und wichtiger Leitungspositionen zum Ausdruck. Dies ist zur Kenntnis zu nehmen und es soll der ausserordentliche Erfolg, der zumindest in seinen Ursprüngen auf anthroposophischen Kernanliegen gründet, durchaus gewürdigt und keinesfalls kritisiert werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht wesentlicher Veränderungen bedarf, damit dem ursprünglichen Unternehmensauftrag noch in angemessenem Umfang nachgekommen werden kann. Kein sinnvoller und zukunftsfähiger Weg scheint es jedoch zu sein, wenn auch hier eine zunehmende Orientierung an der allgemeinen, nichtanthroposophischen Entwicklung gesucht wird, wie es in vielen anderen Kernbereichen leider zunehmend zu beobachten ist. Dazu weiter unten konkretere Gedanken.
Das Heilmittel-Problem
Schon seit Jahren wird insbesondere von Ärzten beklagt, dass die – ohnehin schon äusserst aufwendige – Produktion von Heilmitteln aufgrund der immer weiter gestiegenen gesetzlichen Anforderungen reduziert wird. Der unternehmensseitige Grund dafür liegt darin, dass durch den hohen Aufwand für die Herstellung und Zulassung der Heilmittel, die unterhalb einer gewissen Jahresmenge liegen, nicht rentabel, sondern defizitär sei. (Frage: Gibt es Listen, welche und wie viele Heilmittel in den letzten Jahren aus der Produktion genommen wurden, wieviel davon verkauft wurde, welche noch als Apothekenmittel erhältlich sind und welche gänzlich nicht mehr zu bekommen sind? Ist das irgendwo dokumentiert?)
Dieses Problem besteht zweifellos und seit Jahren existieren Versuche, den Bereich der komplementären Heilmittel zu diskreditieren bis hin zu Versuchen, insbesondere die homöopathischen Mittel regelrecht zu verbieten, was in einigen Ländern bereits erfolgt ist. Es ist ein umkämpftes Gebiet und wird es bleiben.
Abgesehen von der bereits angesprochenen Frage, warum mit den Profiten aus der Naturkosmetik die Defizite aus der Heilmittelproduktion nicht aufgefangen werden können (und stattdessen nun 1% des Umsatzes an Umwelt- und Gemeinwohlorganisationen gespendet werden sollen), sollte nach anderen Wegen gesucht werden, um die Heilmittel, deren Herstellung und Vertrieb für die Weleda nicht sinnvoll möglich ist, dennoch zur Verfügung zu haben. So besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass Apotheken diese als Magistralrezepturen herstellen, da unterhalb einer gewissen Herstellungsmenge die aufwendigen Zulassungsbedingungen nicht gefordert werden. Von der Weleda könnten dazu die notwendigen Rezepturen und die Grundsubstanzen zur Verfügung gestellt werden. Wenn dies entsprechend organisiert würde, in einem Zusammenspiel der Weleda (als Lizenzgeber für die Medikamente, evtl. auch zusammen mit der Wala), mit den Ärzten und einer gewissen Anzahl von geeigneten und zugelassenen Apotheken, die diese Heilmittel herstellen könnten, wäre es zumindest denkbar, auch selten – bis hin zu ganz selten – benötigte Medikamente zur Verfügung stellen zu können.
Dem Autor liegt ein erster Entwurf eines entsprechenden Konzeptes vor, welches zunächst mit Apothekern, Ärzten und ggf. mit der Weleda vorbesprochen werden müsste. Inwieweit sich ein vergleichbares Konzept durch die erwähnte Weleda HealthCare AG in Entwicklung befindet, konnte noch nicht geklärt werden.
Unternehmensaufteilung?
Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Unternehmen, welches zu 80% von einer sehr profitablen Naturkosmetik lebt, diese auch in jeder Beziehung alle materiellen und ideellen Ressourcen eines Unternehmens erfordert und bindet. Es gibt gewiss zwischen der Herstellung der Heilmittel und der Naturkosmetik Synergien in Bezug auf Rohstoffe und teilweise in der Produktion. Spätestens jedoch im Bereich des Absatzes, des Vertriebs, des Marketings, der Produktentwicklung und -gestaltung usw. ergeben sich erhebliche unterschiedliche Anforderungen und Vorgehensweisen. In einem notwendigerweise betriebswirtschaftlich orientierten Umfeld wird schon zwangsläufig der sowohl umsatzmässig als auch ertragsmässig bedeutendere Geschäftsanteil im Vordergrund stehen. Zudem ist der Bereich der Heilmittel eindeutig mehr dem Geistesleben zuzuordnen, als dies für die Naturkosmetik der Fall ist. Auch ohne konkreten Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse ist erkennbar, dass es quasi zwangsläufig zu Interessenskonflikten kommen muss, die allein durch eine organisatorische Trennung (die gewiss vorhanden sein wird) kaum gelöst werden können. Es ist einfach ein Riesenunterschied, einen prosperierenden und hochprofitablen Betrieb zu führen und weiterzuentwickeln als einen, schon aufgrund unbeeinflussbarer äusserlicher Gegebenheiten, sich immer weiter defizitär entwickelnden Betrieb. Dabei ist letzterer (der Heilmittelbereich) aus geistiger Sicht wesentlich bedeutender und wird auch dauerhaft auf Zuwendungen angewiesen sein. Dieser, innerhalb der Weleda insbesondere in den Bereichen der Unternehmensleitung bestehenden Interessenskonflikt könnte dadurch aufgelöst werden, dass die Bereiche eine jeweils vollständig eigenständige Unternehmensleitung erhalten. Denkbar wäre, die Unternehmensteile dazu auch in rechtlicher Hinsicht z.B. in eine Weleda Naturkosmetik AG und eine Weleda Heilmittel AG aufzuteilen. Dabei könnte sowohl ein örtlicher Zusammenhang bis hin zu einer Zusammenarbeit bestehen bleiben, in all den Bereichen, in denen das sinnvoll ist und im gemeinsamen Interesse liegt. Die Unternehmen könnten sich so in ihren unterschiedlichen Kernanliegen unabhängig und ungestört voneinander entwickeln. Selbstverständlich müssten auch weiterhin und auf Dauer Defizite im Heilmittelbereich aus Profiten im Kosmetikbereich abgedeckt werden, als Querfinanzierung wie bisher. Dies dann im Sinne von Schenkgeld, wie es einer Einrichtung des Geisteslebens als Empfänger und einem mehr wirtschaftlich orientierten Unternehmen als Spender gemäss wäre.
Die übergrossen Probleme in nahezu allen Bereichen der Medizin und des Gesundheitswesens haben ihre Ursache darin, dass diese in vollkommen wesensfremder Art und Weise den Paradigmen eines konventionellen Wirtschaftlichkeitsdenkens unterworfen werden.
Verantwortung des AAG-Vorstandes
Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören die Vertretung der AAG und deren Interessen sowohl in der Generalversammlung der Weleda als auch in deren Verwaltungsrat. In diesem Sinne ist der Vorstand Beauftragter der AAG und hat damit deren Interessen respektive die Bedürfnisse der Anthroposophischen Medizin angemessen zu berücksichtigen. Zudem ist er der Mitgliedschaft auch in diesem Zusammenhang rechenschaftspflichtig. Dieser Aufgabe und Pflicht wurde in der Vergangenheit nicht ansatzweise in genügendem Maße nachgekommen. Im Gegenteil wurde zum Beispiel ein eindeutiger Auftrag der Generalversammlung 2011, eine ausserordentliche Generalversammlung zur Weleda durchzuführen, bis heute nicht umgesetzt.
Die Erweiterung des Unternehmenszweckes 2022 (siehe oben) und der Beschluss des Verwaltungsrates, zukünftig jährlich 4,5 Millionen an (nichtanthroposophische) Institutionen des Gemeinwohls bzw. der Umwelt zu spenden, ist eine wesentliche Veränderung des Unternehmenszweckes und entspricht nicht den ursprünglichen Intentionen. Es ist nicht erkennbar, inwieweit diese Beschlüsse, die zweifelsfrei von erheblicher Tragweite sind, im Interesse der AAG bzw. der Anthroposophischen Medizin liegen.
Von diesen Absichten und den entsprechenden Beschlüssen konnte die Mitgliedschaft aus den offiziellen Gesellschaftsorganen nichts erfahren.
Zur Generalversammlung 2022
Die Generalversammlung ist ohne jeden Zweifel das Organ, in welchem die Mitglieder ihrer Verantwortung für die Gesellschaftsverhältnisse nachkommen können, wozu auch der Umgang mit dem Eigentumsanteilen an der Weleda gehört. Um eine derartig schwerwiegende Entscheidung über die endgültige Ausgliederung dieser Eigentumsrechte an der Weleda verantwortlich treffen zu können, sind klare und eindeutige Konzepte notwendig. Autoritätsgläubigkeit ist keine Grundlage für eine sinnvolle Entscheidung. Damit an der GV ein tragfähiger Beschluss gefasst werden kann, ist eine möglichst breite Teilnahme von Mitgliedern notwendig, die sich bereits im Vorfeld der GV informieren konnten. Dem sollen diese und ggf. folgende Ausführungen dienen. So, wie es derzeit aussieht, ist das Vorhaben des Vorstandes weder verständlich erläutert noch überzeugend begründet oder konkret genug entwickelt. Wie im vorigen Absatz gezeigt wurde, ist der Vorstand nicht ansatzweise seinen Aufgaben und Verpflichtungen zur Wahrung der Interessen der AAG, der Anthroposophischen Medizin und der Wahrung der ursprünglichen Unternehmensintentionen der Weleda nachgekommen.
Thomas Heck, 24. März 2022
Anhang: Nachfrage an Justus Wittich vom 21. März 2022
Lieber Herr Wittich,
vielen Dank, dass Sie an unserer Informationsveranstaltung teilgenommen und auch beigetragen haben. Auch vielen Dank für die Richtigstellungen. Dazu haben sich einige Nachfragen ergeben, die kurzfristig geklärt werden sollten.
Sie hatten korrigiert, dass es bei dem ehemaligen Lizenzvertrag nicht um die Rechte an dem Markennamen ging. Unklar blieb allerdings, wofür die Lizenz bezahlt wurde. Sie sprachen davon, dass es ein „Geheimvertrag“ gewesen sei, der zur Zeit von Gisela Reuter (1977 – 1988 im Vorstand) entstanden sei. Wie ist das zu verstehen? Die aus diesem Vertrag resultierenden Zahlungen werden nicht geheim gewesen sein und wurden über 20 Jahre lang geleistet, sodass jedermann davon erfahren konnte, sowohl die IWK als auch bestehende und zukünftige Aktionäre bzw. Partizipationsscheinerwerber. Was war konkret der Gegenstand der Lizenzvereinbarung? Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Vertrag nicht weitergeführt werden konnte und wieso es ein Geheimvertrag gewesen sein soll.
Sie hatten ausgeführt, das die heutige Vorgehensweise vermutlich rechtssicher sei, aber dennoch die Gefahr bestünde, dass ein Aktionär oder Partizipationsscheininhaber auf Gleichstellung klagen könne. In diesem Fall könne dann die Weleda zumindest vorübergehend die jährliche Spende nicht weiter leisten. Haben wir das richtig verstanden? Wenn ja: woraus könnte sich überhaupt der Gleichstellunganspruch begründen lassen? Aus den Statuten? Gibt es konkrete Hinweise, dass jemand einen solchen Anspruch stellen will? Gibt es eine juristische Begutachtung der Fragestellung? Können Sie uns ggf. das Ergebnis zur Verfügung stellen?
In der Hoffnung auf eine Antwort: Vielen Dank im Voraus
Herzliche Grüsse, Thomas Heck
[1] Ein Nachrichtenblatt Nr. 6/2022 und http://www.wtg-99.com/Rundbrief_34.
[2] Die Übertragung zum Nennwert erfordert eine Gegenleistung in dieser Höhe, andernfalls wäre es eine Schenkung. Letzteres scheint jedoch nicht vorgesehen, würde auch zu Bilanzschwierigkeiten der AAG führen (bilanzielle Überschuldung).
[3] Anthroposophie weltweit 3/2009.
[4] https://wtg-99.com/Rundbrief_34.
[5] Der Nennwert bzw. Nominalwert entspricht dem ursprünglichen Wert der Aktie zum Zeitpunkt der Erst-ausgabe. Der Zeitwert gibt den aktuellen Wert wieder. Eine Weleda-Aktie mit dem Nennwert von 1‘000 CHF hat heute den ca. 10-fachen Zeitwert, also 10‘000 CHF.
[6] Stand 24. März 2022.
[7] https://www.finanzen.ch/aktien/weleda-aktie.
[8] http://www.wtg-99.com/Rundbrief_25.
[9] https://www.weledahealthcare.ch/.
[10] https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/ch-de/aktien/beschluesse_97gv_2020.pdf.
[11] AAG und Klinik halten zusammen knapp 80% der Stimmrechte in der GV der Weleda AG.
von Thomas Heck | Mrz 13, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Nein, gewiss nicht. Gerne wird darauf hingewiesen, dass Rudolf Steiner vor jedem Radikalismus in dieser Hinsicht, dem «fanatischen Sichstellen gegen diese Dinge» gewarnt habe. Ausserdem wird bisweilen darauf hingewiesen, dass er sich selber habe gegen Pocken impfen lassen. Bei diesem Hinweis wird es zumeist belassen, um auch mit Rudolf Steiner im Hintergrund eine positive Einstellung zur Impfung gegen SARS-CoV-2 rechtfertigen zu können. Bei näherer Betrachtung erweist sich diese selektive Zitierung jedoch als nicht haltbar. Allerdings lassen sich schon seine Ausführungen zur Ansteckung nicht mit den derzeit vertretenen Annahmen in Einklang bringen, darauf wurde bereits hingewiesen.[1]
Schauen wir uns das Zitat[2] genauer an:
„Und die Pockenimpfung? Da ist man in einem eigentümlichen Fall. Sehen Sie, wenn man jemand impft, und man hat den Betreffenden als Anthroposophen und erzieht ihn anthroposophisch, so schadet es nichts. Es schadet nur denjenigen, die mit vorzugsweise materialistischen Gedanken heranwachsen. Da wird das Impfen zu einer Art ahrimanischer Kraft; der Mensch kann sich nicht mehr erheben aus einem gewissen materialistischen Fühlen. Und das ist doch eigentlich das Bedenkliche an der Pockenimpfung, daß die Menschen geradezu mit einem Phantom durchkleidet werden. Der Mensch hat ein Phantom, das ihn verhindert, die seelischen Entitäten so weit loszukriegen vom physischen Organismus wie im normalen Bewußtsein. Er wird konstitutionell materialistisch, er kann sich nicht mehr erheben zum Geistigen. Das ist das Bedenkliche bei der Impfung. Natürlich handelt es sich darum, daß da die Statistik immer ins Feld geführt wird. Es ist die Frage, ob eben gerade in diesen Dingen auf die Statistik so viel Wert gelegt werden muß. Bei der Pockenimpfung handelt es sich sehr stark um etwas Psychisches. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß da der Glaube, daß die Impfung hilft, eine unberechenbar große Rolle spielt. Wenn man diesen Glauben durch etwas anderes ersetzen würde, wenn man naturgemäß erziehen würde die Menschen, so daß sie beeindruckbar wären durch etwas anderes als dadurch, daß man sie impft, etwa dadurch, daß man die Menschen wiederum an den Geist näher heranbrächte, so wäre es durchaus möglich, daß man gegen das unbewußte Hereindringen: hier ist Pockenepidemie! – durch vollständiges Bewußtsein davon: hier ist ein Geistiges, wenn auch ein unberechtigtes Geistiges, gegen das ich mich aufrechthalten muß! -ebenso gut wirken würde, wie man überhaupt den Menschen stark machen müßte gegen solche Einflüsse.“
Frage: „Wenn die Verhältnisse so liegen, wie zum Beispiel in unserer Gegend, wo die Einwirkung durch die Erziehung und so weiter sehr schwierig ist, wie soll man sich da verhalten?“
Rudolf Steiner: „Da muß man eben impfen. Es bleibt nichts anderes übrig. Denn das fanatische Sichstellen gegen diese Dinge ist dasjenige, was ich, nicht aus medizinischen, aber aus allgemein anthroposophischen Gründen, ganz und gar nicht empfehlen würde. Die fanatische Stellungnahme gegen diese Dinge ist nicht das, was wir anstreben, sondern wir wollen durch Einsicht die Dinge im Großen anders machen. Ich habe das immer, wenn ich mit Ärzten befreundet war, als etwas zu Bekämpfendes angesehen, zum Beispiel bei Dr. Asch, der absolut nicht geimpft hat. Ich habe das immer bekämpft. Denn wenn er nicht impft, so impft eben ein anderer. Es ist ein völliges Unding, so im Einzelnen fanatisch vorzugehen.“
Zunächst zu den schwarzen Pocken. Diese gelten ebenfalls als eine virale Erkrankung. Diese aber mit einer Grippe oder Covid-19 zu vergleichen ist nicht angemessen. Der erste Versuch einer Immunisierung erfolgte bereits 1717 mittels „Variolation“.[3] Dazu entnahm man Material von einer Pocke und ritzte davon eine geringe Menge in die Haut einer anderen Person. Deutlich war, dass dadurch die Krankheit übertragen werden konnte und diese auch wiederum ansteckend war. Damit ist ein durchaus respektabler Hinweis gegeben, dass den Pocken ein Krankheitserreger zugrunde liegt. Vollkommen gegenteilige Erfahrungen machte man 1918, als man mit ähnlichen Methoden versuchte Ansteckungen mit Grippe künstlich vorzunehmen. Nichts davon gelang. (Es kann nur dringend empfohlen werden, sich mit den Tatsachen der Spanischen Grippe zu beschäftigen, da immer wieder Bezüge zu heutigen Situation gezogen werden. Mit Wikipedia kommt man allerdings nicht weiter.[4]) Dies reicht natürlich nicht als wissenschaftlicher Nachweis, korrespondiert jedoch auffallend mit Rudolf Steiner Angaben, gerade in Bezug auf die Ansteckung mit Grippe. Deutlich ist damit, dass die Aussage zur Impfung in Bezug auf die Pocken keineswegs einfach auf die Grippe oder jetzt Corona übertragen werden kann.
Eine Aussage wie diese: „wenn er nicht impft, dann impft eben ein anderer“ von Rudolf Steiner ist unerwartet. Es kann doch nicht sein, dass man etwas tut, nur weil es sonst ein anderer täte? Angesichts der von ihm selber beschriebenen erheblichen Auswirkungen der Pockenimpfung kann er das so nicht gemeint haben. Irritieren kann auch, dass er sich selber habe auch gegen Pocken impfen lassen. So berichtet Hedda Hummel, eine wichtige Stenographin:
„Bekanntlich hatte die Gesellschaft damals einen Kinderhort eingerichtet. In Berlin waren an einer Ecke die Pocken ausgebrochen. So viel ich mich erinnere, wurden in den Schulen und Kinderhorten die Kinder geimpft. Dr. Steiner ordnete an, dass auch die Kinder in unserem Kinderhort geimpft würden und auch die Menschen, die im Kinderhort aus- und eingingen. Dr. Steiner selbst ließ sich auch impfen, auch Frau Dr. Steiner und auch wir alle oder fast alle, die im Hause aus- und eingingen. Dr. Steiner bekam selbst einen schlimmen Arm, die Pocken schlugen an, wie man sagt. Es ging damals der Witz rund, Dr. Steiner mache die Frauenbewegung mit – die darin bestand, dass wir alle, meistens Frauen, eben oft den kranken Arm gerieben haben.“
Wirklich verständlich wird dies allerdings erst, wenn man einbezieht, dass es damals im Deutschen Reich eine Impfpflicht gegen Pocken gab (im Gegensatz zu Österreich, daher war Rudolf Steiner offensichtlich nicht als Kind geimpft worden):
„Obgleich die Pocken also ihr Gefährdungspotenzial verloren hatten und die „Gewissensbedrängnis“ der Zwangsimpfungen in der „Tagespresse und in Volksversammlungen“ immer häufiger Anlass zu heftiger Kritik bot, stand der Impfzwang im Deutschen Reich nicht zur Disposition, im Gegenteil: Seit Ausrufung der Republik wurden Pockenschutzimpfungen rigider denn je durchgesetzt.“[5]
Auch wenn nicht überliefert ist, wann diese Impfungen erfolgten, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine behördliche Massnahme gehandelt hat. So wird die Aussage verständlich, denn die Kinder mussten geimpft werden und wenn der eine Arzt das nicht durchführen wollte, nun, dann musste es eben ein anderer tun.
Mit diesem Hintergrund dürft nun klar sein, dass dieses Zitat von Rudolf Steiner vollkommen ungeeignet ist, ein Impfen gegen Covid-19 zu befürworten.
[1] Siehe mein Rundbrief Nr. 28, https://wtg-99.com/Rundbrief_28.
[2] GA 314, 287f.
[3] Dr. Suzanne Hupfries, Roman Bystrianyk, ”Die Impfillusion”, Rottenburg, 2020, S. 77ff.
[4] Engelbrecht/Köhnlein, aaO, S. 254f. und Impfreport, Seite 4, https://www.impf-report.de/download/impf-report_2005.pdf.
[5] Malte Thießen, „Vom immunisierten Volkskörper zum „präventiven Selbst“. Impfen als Biopolitik und soziale Praxis vom Kaiserreich zur Bundesrepublik“, Oldenbourg Wissenschaftsverlag | 2013 https://www.degruyter.com/document/doi/10.1524/vfzg.2013.0002/html
von Thomas Heck | Mrz 10, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
«Wir leben in einer katastrophalen Zeit. Es wäre natürlich durchaus falsch, wenn man glauben wollte, dass dasjenige, was im Weihnachtssinn katastrophal ist, auch im Ostersinn katastrophal sein müsste. Aus dem Katastrophalen von heute kann sich allerdings gerade das Umgekehrte, das Größte des Menschen Schaffens ergeben, wenn die Menschheit Mittel und Wege findet, um von dem zu lernen und mit geradem Sinne hinzuschauen auf dasjenige, was eingetreten ist.»[1]
Im ersten Teil («100 Jahre AAG?») wurde auf drei verschiedene Zeitstränge im 33 Jahres-Rhythmus hingewiesen, die sich aus den drei Gründungs-Terminen der Anthroposophischen Gesellschaft ergeben:
- Eigentliche Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft: 1902 – 1935 – 1968 – 2001/2
- Gründung der AG in Köln und Johannes-Bau-Impuls: 1912 – 1945 – 1978 – 2011/12
- Weihnachtstagung und Neugründung der AG: 1923 – 1956 – 1989 – 2022/23
Mit Blick auf diesen Rhythmus wurde deutlich, dass insbesondere die Gründungsimpulse von 1902 und 1912 nach jeweils 33, 66 bzw. 99/100 Jahren durch die Auseinandersetzungen in den zentralen Gesellschaftskonflikten verdeckt und vergessen wurden. Die Folgen waren schon rein menschlich zerstörerisch und führten zu Spaltungen, ganz abgesehen von der Missachtung bzw. dem Vergessen der ursprünglichen spirituellen Impulse und der Möglichkeit einer Neuergreifung zu diesen Zeitpunkten. «Denn nachher ist nichts mehr zu erreichen auf demjenigen Wege, auf dem das in dem genannten Zeitraume erreichbar gewesen wäre.»[2] Die Handreichungen aus der geistigen Welt waren nicht ergriffen worden. So stehen wir jetzt, 2022/2023, vor der wohl allerletzten Gelegenheit (für lange Zeit) das wiederum bestehende Entgegenkommen aus der geistigen Welt zu ergreifen.
Auf die konkreten Impulse, die mit der Weihnachtstagung verbunden waren, wird noch zurückzukommen sein.
Der Versuch, abstrakt und akademisch zu ergründen, ob es sich nun um 3 x 32 ⅓, ganze 33 oder 33 ⅓ Jahre handelt,[3] wird nicht weiterführen.[4] Es wird einen zeitlichen Spielraum geben und von 99 Jahren ausgehend korrespondiert das ganze Jahr 2022 mit dem ganzen, sogenannten Schicksalsjahr 1923. Es war das Jahr, in dem Rudolf Steiner versuchte die Gesellschaft vor dem endgültigen Zerfall zu retten, so wies er z.B. an der Delegierten-Tagung Ende Februar 1923 in Stuttgart darauf hin, «dass von diesen drei Tagen das Schicksal der Gesellschaft abhängt.»[5] In diesem Zusammenhang hielt er auch die Vorträge zur Gemeinschaftsbildung (in GA 257).
Wenn man sich vergegenwärtigt, welch apokalyptische Zukunfts-Perspektiven für die Menschheit Rudolf Steiner der Mitgliedschaft nach der Weihnachtstagung eröffnete, für den Fall, dass diese und die Impulse der Anthroposophie nicht genügend aufgenommen und verstanden würden, so tritt das Gesellschaftsschicksal deutlich in den Hintergrund. Rudolf Steiner begann am 1. Juli 1924 über das Karma der Anthroposophen und das der Anthroposophischen Gesellschaft zu sprechen und wies auf die weit über die Gesellschaftsverhältnisse hinausragenden Konsequenzen hin, die sich aus einer ungenügenden Aufnahme der Anthroposophie und der damit verbundenen Impulse ergeben würden. Es müsse eine «spirituelle Erneuerung, die auch das Intellektuelle in das Spirituelle heraufführt, mit dem Ende des 20. Jahrhunderts» eintreten, es bedürfe einer «Wiederspiritualisierung der Kultur im 20. Jahrhundert.» «Dass das eintrete, dürfen sich die Menschen des 20. Jahrhunderts nicht verscherzen! Da aber alles heute vom freien Willen abhängt, so hängt, dass dies eintrete, auch davon ab, ob die Anthroposophische Gesellschaft versteht, im rechten Sinne hingebend die Anthroposophie zu pflegen.» [6] Und weiter:
«Ich habe angedeutet, wie diejenigen Menschen, die mit völliger Intensität drinnen stehen in der anthroposophischen Bewegung, am Ende des Jahrhunderts wiederkommen werden, dass sich dann andere mit ihnen vereinigen werden, weil dadurch eben jene Rettung der Erde, der Erdenzivilisation vor dem Verfall letztgültig entschieden werden muss.»[7]
«Finden sich solche ehrlichen Anthroposophenseelen, die die Spiritualität in dieser Weise in das Erdenleben hineintragen wollen, dann wird es eine Bewegung nach aufwärts geben. Finden sich solche Seelen nicht, dann wird die Dekadenz weiterrollen. Der Weltkrieg mit all seinen üblen Beigaben wird nur der Anfang von noch Üblerem sein. Denn es steht heute die Menschheit vor einer großen Eventualität: vor der Eventualität, entweder in den Abgrund hinunterrollen zu sehen alles, was Zivilisation ist, oder es durch Spiritualität hinaufzuheben, fortzuführen im Sinne dessen, was im Michael-Impuls, der vor dem Christus-Impuls steht, gelegen ist.»[8]
«Kann so gearbeitet werden, wie es von Michael vorbestimmt, prädestiniert ist, dann kommt Europa, dann kommt die moderne Zivilisation heraus aus dem Niedergang. Aber auf keine andere Weise sonst! Dieses Herausführen der Zivilisation aus dem Niedergang ist verbunden mit dem Verständnis von Michael. […] Es geht um Großes, es geht um Riesiges!»[9]
«Und im Laufe dieses 20. Jahrhunderts, wenn das erste Jahrhundert nach dem Kali Yuga verflossen sein wird, wird die Menschheit entweder am Grabe aller Zivilisation stehen oder am Anfang desjenigen Zeitalters, wo in den Seelen der Menschen, die in ihrem Herzen Intelligenz mit Spiritualität verbinden, der Michael-Kampf zugunsten des Michael-Impulses ausgefochten wird.»[10]
Rudolf Steiner hatte mit seinen Äusserungen gewiss vor Augen, welche Abgründe und Katastrophen Mitteleuropa bevorstünden, wenn der Nationalsozialismus in Deutschland herrschende Kraft würde. Dieser aus alten und vollkommen unzeitgemässen okkulten Impulsen gespeisten Bewegung[11] hätte nur Einhalt geboten werden können durch ein Erkennen und ein genügendes Ergreifen der notwendigen spirituellen Impulse. Denn auch diese menschenverachtende und zerstörerische okkulte Bewegung, die ja keineswegs mit dem Dritten Reich untergegangen ist, schöpfte und schöpft aus entsprechenden Quellen:
«Während Michael oben seine Scharen schulte, wurde eine Art unterirdischer, unmittelbar unter der Oberfläche der Erde liegende ahrimanische Schule gegründet. Daher kann man davon sprechen, dass im Überirdischen die Michael-Schule ist; unmittelbar in der Region, auf der wir stehen – denn auch im Unterirdischen ist Geistiges tätig und wirksam -, wurde die ahrimanische Gegenschule begründet. Und wenn von Michael jetzt gerade in dieser Zeit keine Impulse herunterströmten, um die Intelligenz himmlisch zu inspirieren, wenn die Intelligenz auf der Erde sich zunächst selbst überlassen war, so bemühten sich umso mehr die ahrimanischen Scharen, von unten herauf Impulse in die intelligente Menschheitsentwickelung hineinzusenden. Es ist ein gewaltiges Bild, das einem da vor Augen stehen kann. Man stelle sich vor: die Erdoberfläche, oben Michael, seine Scharen belehrend, ihnen mit großen gewaltigen Weltenworten das enthüllend, was die alte Initiatenweisheit war; dem gegenüberstehend die ahrimanische Schule in den Untergründen der Erde. Auf der Erde sich entwickelnd die vom Himmel herabgefallene Intelligenz; Michael zunächst gegenüber dem Irdischen in himmlischer Einsamkeit Schule haltend – keine Strömungen gehen von oben nach unten – , die ahrimanischen Mächte umso mehr ihre Impulse nach oben sendend.»[12]
Dieses Widersacherwirken, welches sich seit dem Sturz der Geister der Finsternis zum Ende des 19. Jahrhunderts erheblich verstärkt hatte, ist gewiss nach wie vor Realität im Weltgeschehen. Und auch der Materialismus, hat sich seit 1879 erheblich gesteigert. Die Widersacher und deren Wirken sind Realitäten und mehr denn je aktiv, man denke nur an Rudolf Steiners Aussagen zu 1998 (in GA 346), der zu erwartenden Inkarnation Ahrimans (in GA 192 und GA 193) und der Hinweise zu den Hintergründen des Weltgeschehens (in «Zeitgeschichtliche Betrachtungen», u.a. in GA 173).
«Und die materialistische Weltanschauung kann genannt werden: die große Verschwörung gegen den Geist. Diese materialistische Weltanschauung ist nicht bloß ein Irrtum, sie ist eine Verschwörung, die Verschwörung gegen den Geist.»[13]
1923
Für die Entwicklung des Jahres 1923 kommen zumindest zwei Aspekte in Betracht: Einerseits die Gesellschaftssituation und andererseits die sich anbahnende Katastrophe in Mitteleuropa durch den Nationalsozialismus.
Die Gesellschaft hatte sich nicht wie erhofft entwickelt. Es hatte sich ab 1914 eine «innere Opposition», eine innere Gegnerschaft gebildet. Nach dem Krieg konnte die esoterische Arbeit aus inner-gesellschaftlichen Gründen nicht wieder aufgegriffen werden. Auf der anderen Seite nahm das öffentliche Interesse an der Anthroposophie zu und erreichte 1922 einen Höhepunkt.[14] Auch wenn die äussere Gegnerschaft stark zugenommen hatte, lag der hauptsächliche Grund dafür, dass Rudolf Steiner sein öffentliches Wirken nahezu vollständig aufgeben musste, in dem ungenügenden inneren Rückhalt und Verständnis aus der Mitgliedschaft. Die Situation kulminierte zum Jahreswechsel 1922/23 mit dem Brand des Goetheanum – weder er selber noch der Bau konnten durch die Mitgliedschaft ausreichend geschützt werden. Das Folgejahr 1923 war geprägt von dem Versuch, die gesamte Situation zu konsolidieren, um überhaupt weiterarbeiten zu können – allerdings erwies sich die Gesellschaft als weitgehend konsolidierungsresistent, sodass Rudolf Steiner erwog, die anthroposophische Bewegung ausserhalb der Gesellschaft weiterzuführen, sich aus dieser gänzlich zurückzuziehen.[15] Und die Dreigliederungs-Bemühungen mussten als gescheitert bezeichnet werden:
«Man möchte sagen, als von dem Dreigliederungsimpuls im sozialen Leben gesprochen worden ist, da war das gewissermaßen eine Prüfung, ob der Michael-Gedanke schon so stark ist, dass gefühlt werden kann, wie ein solcher Impuls unmittelbar aus den zeitgestaltenden Kräften herausquillt. Es war eine Prüfung der Menschenseele, ob der Michael-Gedanke in einer Anzahl von Menschen stark genug ist. Nun, die Prüfung hat ein negatives Resultat ergeben. Der Michael-Gedanke ist noch nicht stark genug in auch nur einer kleinen Anzahl von Menschen, um wirklich in seiner ganzen zeitgestaltenden Kraft und Kräftigkeit empfunden zu werden.»[16]
Bereits ein Jahr zuvor: «Denn der Zeitpunkt, wo man das, was in den ‹Kernpunkten der sozialen Frage› steht, realisieren sollte, der ist vorüber für Mitteleuropa.»[17]
Wie sehr sich die Situation in Bezug auf die Dreigliederung bereits 1923 geändert hatte, brachte er an der Weihnachtstagung, am 31. Dez. 1923 zum Ausdruck: «Wenn heute einer die Dinge [die Dreigliederung] in derselben Weise vertritt, mit der man sie 1919 vertreten hat, man da um Jahrhunderte zurückgeblieben ist.»[18]
Aber das Jahr 1923 war auch in anderer Hinsicht ein Schicksalsjahr – insbesondere für Mitteleuropa, und weit darüber hinaus.
In Deutschland entwickelte sich der Nationalsozialismus, eine zweifellos «antianthroposophische Bewegung»,[19] die auch an den Störungen und Angriffen auf Rudolf Steiner in München und Velbert beteiligt war. Insbesondere der 9. Nov. 1923, an dem der blutig niedergeschlagene Ludendorff-Hitler-Putsch stattfand, wurde von ihm sehr ernst genommen (rückblickend zu Recht, denn das Geschehen führte zu einem schwarzmagischen Totenkult und der 9. November war der höchste Feiertag im Dritten Reich[20]). Er reagierte sofort, als er am 10. November Kenntnis von dem Putsch genommen hatte und beschloss, den Berliner Wohnsitz aufzugeben und den Philosophisch-Anthroposophischen Verlag nach Dornach zu verlegen.[21] Zu dem Putsch äusserte er sich wie folgt: «Wenn diese Gesellschaft sich durchsetzt, bringt dies für Mitteleuropa eine große Verheerung.»[22]
Rudolf Steiner waren die okkulten Hintergründe des Nationalsozialismus sehr bewusst, ebenso wie das mögliche Schicksal Mitteleuropas, die Gefahren für die Menschheitsentwicklung und für die Erdenmission, wenn sich diese Kräfte durchsetzen könnten. Insofern war die Weihnachtstagung und die Neugründung keineswegs eine reine Gesellschaftsangelegenheit, mit dem erhofften «Welten-Zeitenwende-Anfang» ging es um die Rettung der Menschheitsmission, wie aus den oben angeführten Zitaten deutlich hervorgeht, es ging um die «Rettung der Erde, der Erdenzivilisation vor dem Verfall.»[23]
Mit Blick auf diesen Hintergrund kann verständlich werden, warum Rudolf Steiner die erheblichen Risiken einging, die mit der «Tat» der Weihnachtstagung und der Neugründung verbunden waren. Einerseits bestand das Risiko, dass der Strom der Offenbarungen abbrechen könnte, wenn die Tat von der geistigen Welt nicht angenommen würde. Andererseits kam nun alles darauf an, dass die Mitgliedschaft in genügendem Masse die Impulse verstehen und ergreifen würde. Andernfalls könnte die Situation eintreten, dass es «besser gewesen [wäre], man hätte sich [zur Weihnachtstagung] nicht versammelt.»[24] Noch deutlicher hatte sich Rudolf Steiner gegenüber Ita Wegman geäussert:
«Mächtig war dann die Weihnachtstagung. Sie war so mächtig, dass Rudolf Steiner sogar zu mir sagte, dass nachdem er alle Elemente, alle Geistigkeit aufgerufen habe, und wenn die Menschen von jetzt ab nicht auch geistig sich entwickeln würden, ein ungeheurer Rückschlag eintreten würde. ‹In früheren Zeiten›, sagte er noch‚ ‹hätte ein Mensch, der einen solchen esoterischen Akt vollzogen hätte, dieses vielleicht sogar mit einem plötzlichen Tod bezahlen müssen. Jetzt mit der Christuskraft sind solche Dinge möglich, und weil die Menschheit in ihrem jetzigen Zustand es braucht, müsse man das Vertrauen, auch den Mut dazu haben, solche gewaltigen Dinge zu tun.›»[25]
So war 1923 eine Gelegenheit gegeben, einerseits zu einer Gemeinschafts- bzw. Gesellschaftsbildung, im Sinne einer Bruderschaft (wie im ersten Teil ausgeführt), welche für einen «Welten-Zeitenwende-Anfang» notwendig gewesen wäre. Und andererseits bestand die Möglichkeit, den aus alten, vorchristlichen Herrschaftsimpulsen wirkenden nationalsozialistischen Intentionen einen zukunftsfähigen, freiheitlich-spirituellen Entwicklungsimpuls entgegenzustellen.
1956
Es würde an dieser Stelle zu viel Raum einnehmen, die relevanten Ereignisse der Jahre 1956 und 1989 ausführlich zu beschreiben. Dies wird nur in aller Kürze möglich sein, weitere Informationen finden sich im Internet, für einen ersten Überblick sind die Darstellungen bei Wikipedia durchaus geeignet.
Ungarn
Nach dem 2. Weltkrieg war Ungarn Bestandteil des Warschauer Pakts, hatte eine autoritäre kommunistische Regierung und das sowjetische Militär war als Besatzungsmacht im Land stationiert. Schon 1955 entstand eine Freiheitsbewegung, die dann im Jahr 1956 auch politische Forderungen stellte (z.B. die Unabhängigkeit studentischer Organisationen). Wohl angeregt durch den polnischen Arbeiteraufstand des gleichen Jahres, durch den die Besetzung des Postens des ersten Sekretärs des Zentralkomitees gegen den Willen der Sowjets durchgesetzt und eine militärische Intervention abgewendet werden konnte, kam es am 23. Oktober zu einer friedlichen studentischen Demonstration in Budapest. Diese eskalierte, als die Regierung am Abend in die schnell wachsende Menge schiessen liess. Damit entstand eine bewaffnete Auseinandersetzung, die Regierung wurde gestürzt und durch eine aus verschiedenen Parteien gebildete ersetzt. Der Warschauer Pakt wurde gekündigt und Ungarn für neutral erklärt. Dem inzwischen verstärkten sowjetischen Militär war diese von breiten Schichten getragene Revolution jedoch nicht gewachsen, der Aufstand wurde bereits am 4. November 1956 militärisch niedergeschlagen. In der nachfolgenden Säuberung wurden hunderte Aufständische durch die Machthaber hingerichtet, zehntausende wurden eingekerkert oder interniert und hunderttausende Ungarn flüchteten in den Westen. Der Impuls, liberale und menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen, war zunächst gescheitert. Ein Erfolg hätte schon damals den Zusammenhalt des Ostblocksystems in Frage gestellt. Der Westen hatte offensichtlich kein Interesse an Veränderungen, ausser verbalen Äusserungen gab es keine Unterstützung für die Aufständischen. Der 23. Oktober wurde 1989, 33 Jahre später, zum Nationalfeiertag erklärt.
Ägypten – Naher Osten
Etwa zur gleichen Zeit versuchte Ägypten sich aus der Übermacht der Kolonialmächte zu befreien. Im Vordergrund standen die Nutzungsrechte des Suezkanals. Dieser wurde 1956 von dem ägyptischen Regierungsoberhaupt Abdel Nasser verstaatlicht. Nach ergebnislos verlaufenen Verhandlungen erfolgte eine gemeinsame militärische Intervention und Besetzung ägyptischen Staatsgebietes durch französisches, englisches und israelisches Militär («Suez-Krise», «Sinai-Feldzug»). In ungewöhnlicher Einigkeit erzwangen die USA gemeinsam mit der UdSSR mithilfe der UNO die Beendigung der Besetzung. Auch wenn Ägypten militärisch hoffnungslos unterlegen war, konnte es so politisch einen Sieg für sich proklamieren. Der von den Angreifern geplante und erhoffte Sturz Abdel Nassers wurde nicht erreicht und der Suezkanal stand fortan unter ägyptischer Kontrolle.
Deutlich konnten die Hegemonial-Mächte ihre Interessen durchsetzen und die Liberalisierungsbestrebungen der Bevölkerung verhindern. Dies galt auch für Ägypten, welches sich fortan enger mit der UdSSR verbündete. Die der freiheitlichen Entwicklung entgegenstehenden Kräfte konnten sich mit militärischer Gewalt durchsetzen.
1989
Die Ereignisse von 1989 sind vielen Zeitgenossen noch geläufig, so kann hier auch nur an weniges erinnert werden. Es war das Jahr, in dem das «sozialistische Experiment»[26] nach 72 Jahren endete bzw. beendet wurde. Gewiss hatten die beharrlichen Demonstrationen, die in der damaligen DDR insbesondere von den Montagsgebeten in der Nikolaikirche in Leipzig ausgingen und im Herbst sehr schnell zu grossen Demonstrationen führten, einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung. Andererseits scheint es aber auch irgendeine Art von Einvernehmen sowie Absprachen im Hintergrund gegeben zu haben, dieses Experiment nun zu beenden. Dennoch bleibt für diejenigen, die diese Vorgänge miterleben bzw. mitverfolgen konnten, das damalige Geschehen eindrucksvoll. Man erinnere sich an die Besetzung der Botschaft in Prag, die Reaktionen auf die Ausreisegenehmigungen und die Bilder des 9. November 1989, als die Mauer fiel. Aber schon zuvor, im Juli und August, hatte ausgerechnet Ungarn zumindest teilweise die Grenze geöffnet und liess DDR-Bürger ungehindert ausreisen.
So schien das westlich orientierte, vermeintlich freiheitliche Modell der repräsentativen Demokratie auch im ehemaligen Ostblock seinen Siegeszug fortzusetzen.
2022
Inzwischen sollte sich weitgehend gezeigt haben, dass gerade mit dem Modell der repräsentativen Demokratie einerseits und mittels angeblicher Wissenschaftlichkeit andererseits die Grundrechte in der ebenfalls vermeintlichen freien Welt massiv eingeschränkt wurden – und kaum zu erwarten ist, dass diese in vollem Umfang innerhalb der bestehenden politischen Systeme wiederhergestellt werden. Gerade in den letzten Jahren, vor der sogenannten Pandemie, wurde durch Prof. Rainer Mausfeld deutlich herausgearbeitet, dass es sich bei der repräsentativen Demokratie nur vermeintlich um Demokratie handelt. Inzwischen sollte sich in breiteren Kreisen die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass es eine kleine Gruppe von Oligarchen ist, die versuchen, die Welt zu beherrschen. Denn es zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass die «repräsentative Demokratie» als Mittel «zur Verhinderung von Demokratie»[27] installiert wurde, wie Rainer Mausfeld eindrücklich beschreibt: «Die Erfinder dieses Modells [der repräsentativen Demokratie], die Gründerväter der amerikanischen Verfassung, entwickelten mit diesem Konzept einen Demokratiebegriff, der seiner Natur nach das Modell einer wirklichen, also partizipatorischen Demokratie auf der Basis einer ungeteilten souveränen Selbstgesetzgebung des Volkes ausschloss. Für diese Form einer durch demokratische Wahlen legitimierten Oligarchie [Herrschaft von wenigen] wurde die Bezeichnung ‹Demokratie› beibehalten, um das Bedürfnis des Volkes nach einer Volksherrschaft zu befriedigen – und zwar durch die Illusion von Demokratie.»[28]
Als in Deutschland nach dem Kaiserreich um ein neues politisches System gerungen wurde, sagte Rudolf Steiner dazu:
«Man kann sich kaum etwas Unglücklicheres denken als den Aberglauben, dass es einen Zauber bewirken werde, wenn man zu dem übrigen, was man sich hat von England gefallen lassen, nun auch noch das fügt, dass man sich die demokratische Schablone von ihm aufdrängen lässt. Damit soll nicht gesagt werden, dass Mitteleuropa nicht im Sinne einer inneren politischen Gestaltung eine Fortentwickelung erfahren solle, allein eine solche darf nicht die Nachahmung des westeuropäischen sogenannten Demokratismus sein, sondern sie muss gerade dasjenige bringen, was dieser Demokratismus in Mitteleuropa wegen dessen besonderer Verhältnisse verhindern würde. Dieser sogenannte Demokratismus ist nämlich nur dazu geeignet, die Menschen Mitteleuropas zu einem Teile der englisch-amerikanischen Weltherrschaft zu machen, und würde man sich dazu auch noch auf die sogenannte zwischenstaatliche Organisation der gegenwärtigen Internationalisten einlassen, dann hätte man die schöne Aussicht, als Mitteleuropäer innerhalb dieser zwischenstaatlichen Organisation stets überstimmt zu werden.»[29]
Aktuell gibt es auch aus der Bevölkerung heraus Bestrebungen zu einer Liberalisierung der Verhältnisse, man denke nur an die vielen Demonstrationen 2020 und derzeit die zahlreichen Spaziergänge in Deutschland, an denen Hunderttausende teilnehmen an mehr als 1.500 Orten. Wie 1989 in der DDR wird an einigen Orten versucht, «runde Tische» mit den örtlichen Politikern zu initiieren und mit diesen ins Gespräch zu kommen. Zu diesem Widerstand gegen die als unangemessen angesehenen Corona-Massnahmen gehören auch die Trucker-Proteste in Kanada, die aktuell Widerstandsbewegungen in anderen Ländern als Anregung dienen. Deutlich ist, dass hier Bewegungen aus der Bevölkerungen entstehen – der einzig angemessene und zeitgemässe Weg, unsere sozialen Verhältnisse zu gestalten. An dieser Stelle sei auch auf das aktuell wachsende Interesse an der Dreigliederung nebst entsprechenden Initiativen hingewiesen.
Schlussfolgerung und Ausblick
Als Rudolf Steiner damals auf den 33-Jahres Rhythmus hinwies, konnte man diesen zunächst nur im Rückblick auf die gewordene Geschichte anwenden. Seitdem dieses Wissen jedoch in der Welt ist, können wir uns nicht damit begnügen. Wenn es also richtig ist, dass nun, nach 99 Jahren eine besonders günstige Gelegenheit besteht, sich um die damaligen Impulse (im Sinne einer letzten Gelegenheit) zu deren Erneuerung bzw. Aufgreifen oder gar Realisieren mit besonderer Unterstützung aus der geistigen Welt zu bemühen, so ergibt sich für den, der dies erkennt, eine Mitverantwortung für die weitere Entwicklung, für das Geschehen in der Welt. Wenn man mit diesem Blick konkret auf das Jahr 1923 schaut, so ergeben sich zunächst folgende Aufgabenfelder – ganz unabhängig von einem gesellschaftlichen oder institutionellen Zusammenhang:
- Rudolf Steiner hat damals insbesondere den Verantwortlichen der Gesellschaft schonungslos den Spiegel vorgehalten, drängte auf (Selbst-)Erkenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, in dem Sinne, dass nur auf der «Grundlage der Erkenntnis der Mangelhaftigkeiten – die ja wohl zugegeben werden –, also der konkreteren Erkenntnis desjenigen, was mangelhaft ist, zu einer Gestaltung des Positiven geschritten»[30] werden kann. Die notwendige gesellschaftliche Selbsterkenntnis war damals nicht möglich. Hier stellt sich die Frage, ob es heute anders ist? Die Aufgabe, den Spiegel vorzuhalten, kann heute nur aus der Mitgliedschaft ergriffen werden und bedarf erfahrungsgemäss einer gewissen Öffentlichkeit. Zum Teil geschieht dies immer wieder, eine Bündelung, der Versuch, eine Überschau zu ermöglichen, könnte die Voraussetzung für ein weiteres Vorgehen sein, welches zur «Gestaltung des Positiven» führen könnte.
- Als weiteres wurde von Rudolf Steiner auf die Notwendigkeit der Gemeinschaftsbildung hingewiesen, im Sinne eines umgekehrten Kultus, somit eine mit spirituellem Bewusstsein durchdrungene Gemeinschaftsbildung. Dies war nicht in dem erforderlichen Masse entstanden, bereits 1905 war auf die Notwendigkeit und die daraus entstehenden Möglichkeiten hingewiesen worden: «Vereinigung bedeutet die Möglichkeit, dass ein höheres Wesen durch die vereinigten Glieder sich ausdrückt. … So sind die menschlichen Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten, in welche sich höhere geistige Wesenheiten herniedersenken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die Glieder des Körpers wirkt. … Zauberer sind die Menschen, die in der Bruderschaft zusammen wirken, weil sie höhere Wesen in ihren Kreis ziehen. … Der Zukunft obliegt es, wieder Bruderschaften zu begründen, und zwar aus dem Geistigen, aus den höchsten Idealen der Seele heraus.»[31] Damit liegt eine Aufgabe vor, die nur in einem konkreten überschaubaren menschlichen Zusammenhang realisierbar ist. Rudolf Steiner hielt die Vorträge zur Gemeinschaftsbildung am 27. und 28. Febr. 1923 an der damaligen Delegiertentagung in Stuttgart (und anschliessend in Dornach vor der dort lebenden Mitgliedschaft). Damit war gewiss die Hoffnung verbunden, dass die Zuhörer diese Gedanken in ihre konkreten menschlichen Verhältnisse trugen, damit diese die erforderliche spirituell-gemeinschaftliche Grundlage für den notwendigen Gesellschaftszusammenhang bilden konnten.
Aber haben wir das alles nicht schon zur Genüge versucht und sind immer wieder gescheitert? Gewiss, aber ging es Rudolf Steiner anders? Trotz verständlicherweise bestehender Frustrationen und Resignationen könnten individuelle und gemeinschaftliche Bemühungen, ausgehend von den Initiativen einzelner, gerade jetzt lohnen, längst aufgegebenen Ideen und Hoffnungen doch noch aufleben zu lassen. Wenn es richtig ist, dass jetzt besondere Möglichkeiten bestehen, auch im Sinne einer letzten Gelegenheit, so müsste das doch bemerkbar sein!
Das Jahr 2022 hat gerade erst begonnen. Es ist noch einiges möglich.
Nachtrag
Dieser Beitrag war bereits fertig, als am 22. Febr. 2022 russisches Militär aktiv in den schwelenden Ukraine-Konflikt eingriff. Mit unerwarteter Deutlichkeit wird der Bezug zu den vergangenen Ereignissen offenbar, denn es ist wiederum eine Ost-West-Auseinandersetzung, die nun zu einem heissen Konflikt geworden ist – wir wissen nicht, was daraus werden wird. Vor 3 x 33 Jahren wurden die Weichen gestellt, die zu den Ost-West-Auseinandersetzungen führten. Denn hätten das Dritte Reich und die Naziherrschaft verhindert werden können, wäre die Spiritualisierung der Zivilisation aus der Anthroposophie heraus möglich geworden, hätte dieser Ost-West-Gegensatz sich nicht in dieser Schärfe ausleben müssen, wie es geschehen ist, und wie wir es jetzt wieder erleben. Aktuell werden nun die ganzen Illusionen offenbar, die mit den Ereignissen von 1989 verbunden waren.
Thomas Heck, 27. Februar 2022
[1] GA 180, 1980, S. 81.
[2] GA 185, 1982, S. 95.
[3] Eine schlüssige Begründung mit konkretem Bezug auf Rudolf Steiner, dass es sich doch um 3 x 33 1/3 Jahre handeln würde, habe ich bisher nicht erhalten. Insofern gehe ich von 99 Jahren aus, auch wenn 99/100 geschrieben wird.
[4] Wer sich mit dieser Frage näher beschäftigen möchte, sei die Übersicht von Jens Göken «Das Gesetz der 3 x 33 Jahre» empfohlen: www.wtg-99.com/33Jahre.
[5] GA 259, S. 390.
[6] GA 240, 1977, S. 161.
[7] GA 237, S. 142, Dornach, 3. August 1924
[8] GA 240, 1992, S. 307,
[9] GA 240, S. 180.
[10] GA 240, S. 183.
[11] TH in www.wtg-99.com/Rundbrief_08 und www.wtg-99.com/Rundbrief_15 . Dieter Schäfer: «Der Christus-Diener und das Sorat-Medium», ENB 17/2019.
[12] GA 240, 1992, S. 191.
[13] GA 254, 1986, S. 266.
[14] Rudolf Steiner sprach vor vollen Sälen, z.B. in der Berliner Philharmonie mit 1.600 Plätzen und beim Ost-West-Kongress in Wien vor 2.000 Zuhörern.
[15] Ausführungen zu den möglichen Konsequenzen in TH, «Ein aphoristisches Fragment», https://wtg-99.com/Aphoristisches-Fragment.
[16] GA 223, 1990, S. 50f., Dornach 1923.
[17] GA 305, 1991, S. 205, Oxford 1922.
[18] GA 260, S. 219.
[19] Nach Karl Heyer.
[20] Siehe hierzu: TH, «Zum 9. November», Rundbrief 8, https://wtg-99.com/Rundbrief_8.
[21] GA 259, S. 862f.
[22] Karl Lang, Lebensbegegnungen, S. 67, hier zitiert nach GA 259
[23] GA 238, 1991, S. 142.
[24] GA 260a, 1987, S. 92. (Hervorhebung vom Verfasser.)
[25] Zitiert nach Emanuel Zeylmans van Emmichoven, «Wer war Ita Wegman», Bd. 2.
[26] GA 174b, 1994, S. 359f.
[27] Rainer Mausfeld: «Die Angst der Machteliten vor dem Volk». Transkript eines Vortrages. Quelle: https://www.uni-kiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Mausfeld_Die_Angst_der_Machteliten_vor_dem_Volk.pdf.
[28] Rainer Mausfeld: «Warum schweigen die Lämmer», 2. Aufl., o.J., Westend-Verlag. Im Internet sind viele Vorträge von Rainer Mausfeld zu finden, zumeist Videos, aber auch Transskripte.
[29] GA 24, 1982, S. 350, «Erstes Memorandum», Juli 1917,
[30] GA 259, S. 377, Stuttgart 26. Februar 1923.
[31] GA 54, 1983, S. 192f. und GA 265, 1987, S. 122.
von Thomas Heck | Feb 27, 2022 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
„Wenn die Menschen dem Genius eines Zeitalters absagen, dann tritt an sie heran der Dämon dieses Zeitalters.“ Rudolf Steiner[1]
In Bezug auf die Umlaufszeiten geistiger Impulse spricht Rudolf Steiner eigentlich von einem Zeitraum von 3 x 33, also 99 Jahren, wonach diese erneuert bzw. wieder aufgegriffen werden können.[2] Geschieht dies nicht, so könne zumindest für sehr lange Zeit daran nicht mehr angeschlossen werden mit der Folge, dass diese Impulse den Widersacherkräften überlassen werden müssen. Die Möglichkeit einer Erneuerung kann nun nichts anderes bedeuten, als dass zu den entsprechenden Zeiten seitens der geistigen Welt die entsprechenden Voraussetzungen zu einer Erneuerung bestehen. Es liegt also keineswegs in der Beliebigkeit der Menschen, wann dies geschehen kann. Doch nur wenn diese geistigen Impulse von Menschen erkannt und aktiv ergriffen werden, nur dann kann die Erneuerung Realität werden. Es hängt also alles davon ab, ob für ein mögliches Wiederergreifen ein realistisches Bewusstsein und ein notwendiger Wille vorhanden ist.
Damit ergeben sich als Voraussetzung:
- Eine realistische/wahre Erkenntnis des ursprünglichen Impulses.
- Eine zeitlich richtige Zuordnung, da nur zu bestimmten Zeiten die Erneuerungsmöglichkeit besteht.
- Eine realistische Erkenntnis der damaligen und heutigen Kräfte, die einer möglichen Ergreifung entgegenstehen.
Nun gehört es zu den Besonderheiten der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, dass ausgerechnet an unrichtigen und unwahren Bildern der eigenen Geschichte – insbesondere um das Geschehen und die Tatsachen an und nach der Weihnachtstagung – auch dann festgehalten wird, wenn die Realität für jedermann erkennbar geworden ist. Nachfolgend dazu einige Beispiele, auf die in späteren Ausarbeitungen konkret eingegangen werden kann:
- Der Grundstein-Spruch ist zu differenzieren von dem Grundstein selber.
- Dieser wurde nicht von Rudolf Steiner „in die Herzen der Mitglieder“ gelegt!
- Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft wurde nicht an der Weihnachtstagung, sondern bereits 1913 gegründet.
Weitergehend ergibt sich zwischen dem, was heute zumeist unter dem Impuls der Weihnachtstagung verstanden wird eine Differenz zu dem, was Rudolf Steiner mit dieser Formulierung zum Ausdruck brachte. Und wenn auch heute vom „100-jährigen Fortwirken der Weihnachtstagung“[3] gesprochen wird, so ist das Hypothetische des gesamten Weihnachtstagungs-Geschehens und der Neugründung der Gesellschaft, worauf R. Steiner immer wieder hingewiesen hatte, offensichtlich aus dem Blick geraten.
Mit diesen wenigen Sätzen ist ein ganzes Bündel von Themen angesprochen, die nur nach und nach angeschaut werden können, um Klarheit zu bekommen für die nun bevorstehende säkulare Wiederkehr der Weihnachtstagung. Erst durch die Beantwortung bzw. Klärung offener Fragen kann ein realistisches Bild entstehen und damit die Voraussetzung dafür, an eine Möglichkeit zur Erneuerung der damaligen Impulse auch nur zu denken. Ob, inwieweit und woran wir heute noch anknüpfen können, muss sich ebenfalls aus der Klärung ergeben.
Auch wenn nachfolgend vornehmlich die Gesellschaftsgründungen in den Blick genommen werden, ist die Bedeutung keineswegs auf die heutigen Gesellschaftsverhältnisse begrenzt, im Gegenteil, sind doch gerade die mit der Weihnachtstagung verbundenen Absichten von Bedeutung für die ganze Menschheitsentwicklung.
99 oder 100 Jahre?
Dieser Frage soll hier nicht nachgegangen werden, dies ist anderweitig bereits ausführlich geschehen und diskutiert worden, darauf sei hier lediglich verwiesen.[4] Ich gehe davon aus, dass es nicht falsch sein kann, bereits 99 Jahre zu berücksichtigen und es ist sicher ein gewisser Spielraum gegeben um diesen Zeitpunkt. Man kann aber auch die Frage haben, ob es sich bei den üblich gewordenen 100 Jahren um einen Trick der Widersacher handelt, damit eine Verspätung eintritt. Während zum 100. Geburtstag Friedrich Schillers 1859 ein Schiller-Jahr begangen wurde, hat Rudolf Steiner genau dieses als das Todesjahr des eigentlichen Idealismus bezeichnet.[5]
So kann diese Frage offen bleiben – mit der Möglichkeit, eine Verspätung zu vermeiden.
Der richtige Zeitpunkt?
Begriffsklärung
Nun ist nicht nur die säkulare Wiederkehr der Weihnachtstagung in den Blick zu nehmen, sondern auch die damit verbundene Neugründung der Gesellschaft. Von der Gesellschaftsleitung wird nach wie vor öffentlich und offiziell vertreten, dass die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft an der Weihnachtstagung von Rudolf Steiner gegründet worden sei.[6] Als 2019 zu den Kolloquien zur Klärung der Konstitutionsfrage eingeladen wurde, erfolgte dies „im Hinblick auf das Ereignis ‹100 Jahre Gründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft› 2023/24“.[7] Aber genau in dieser Formulierung wird schon die hier angesprochene Problematik deutlich, denn sowohl die Gesellschaftsleitung als auch die Mitgliedschaft glaubte eben seit 1925, dass es sich bei der „Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft“ um die an der Weihnachtstagung 1923/24 neugegründete Gesellschaft handeln würde, man also in der AAG Mitglied der Weihnachtstagungs-Gesellschaft sei. Tatsächlich aber handelt es sich bei der AAG um den am 8. Febr. 1925 in „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“ umbenannten „Verein des Goetheanum freie Hochschule für Geisteswissenschaft“, den sogenannten Bauverein. Dieser ging zurück auf die Gründung des „Johannesbau-Vereins“ in Basel im Jahr 1913 und hatte seinen eigentlichen Ursprung in der Gründung eines gleichnamigen Vereins in München im Jahr 1910.[8] Davon war (und ist) streng zu unterscheiden die an der Weihnachtstagung neugegründete Gesellschaft namens „Anthroposophische Gesellschaft“.[9]
Obwohl bereits an der Generalversammlung 1963 durch engagierte Mitglieder die wirklichen Tatsachen vorgebracht wurden und damit im Gesellschaftszusammenhang bekannt geworden waren, hat sich der Glaube, die AAG sei mit der Weihnachtstagungs-Gesellschaft identisch, bis heute gehalten. Anstatt 1963 in einen notwendigen Erkenntnisprozess einzutreten, wurde die weitere Diskussion verhindert, indem die damaligen Protagonisten rechtzeitig vor der nächsten Generalversammlung aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Seitens der Leitung wurde bis Ende der 90er Jahre geleugnet, dass es überhaupt ein Problem mit der Konstitution gibt.
Auf die Fragestellungen zur Konstitution wird demnächst detaillierter eingegangen werden können, wenn ein zumindest vorläufiges Ergebnis aus der 2-jährigen Kolloquiums-Arbeit zur Konstitution der AAG veröffentlicht werden wird.
Nachfolgend wird nun unterschieden:
- Die „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“, bei der es sich um den am 8. Febr. 1925 umbenannten „Johannesbau-Verein“ handelt. Dieser Verein ist mit der heutigen AAG identisch, in der viele von uns Mitglied sind.
- Die an der Weihnachtstagung 1923/24 neugegründete „Anthroposophische Gesellschaft“, die zur Unterscheidung hier auch Weihnachtstagungs-Gesellschaft genannt wird.
Wann wurde die „Anthroposophische Gesellschaft“ gegründet?
Rudolf Steiner erinnert nach der Weihnachtstagung an die Gründung der „Anthroposophischen Gesellschaft“ und bezieht sich dabei explizit auf den Beginn der anthroposophischen Arbeit im Jahr 1902 (!) im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft:
„Als aus dem Schosse der Theosophischen Gesellschaft heraus im Beginne des Jahrhunderts in Berlin die Anthroposophische Gesellschaft begründet worden ist, …“[10] und „Die Anthroposophische Gesellschaft hat ja in sehr, sehr kleiner Form begonnen, und diese kleine Form war dazumal im Beginne des Jahrhunderts in der Theosophischen Gesellschaft enthalten.“[11]
Allein aus diesen Bemerkungen wird die Kontinuität deutlich, die er dem gesellschaftlichen Verhältnis beimisst, abseits formaler oder juristischer Gegebenheiten: Sowohl die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft 1912 als auch die Neugründung an der Weihnachtstagung 1923/24 stehen in diesem Kontinuitäts-Strom seit der Gründung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft 1902 und der Übernahme der Aufgabe des Generalsekretärs durch Rudolf Steiner. Ganz unabhängig von den äusseren Formen wurden diese Gesellschaften nicht unterschieden – in seinem Verständnis ist es immer die gleiche Gesellschaft! Die Gründung 1912 erfolgte, weil sich die Bedingungen in der Theosophischen Gesellschaft geändert hatten:
„Und wären Gesinnung, Haltung und Wirken der [Theosophischen] Gesellschaft so geblieben, wie sie damals waren, mein und meiner Freunde Austritt hätte nie zu erfolgen gebraucht. Es hätte nur innerhalb der Theosophischen Gesellschaft die besondere Abteilung ‹Anthroposophische Gesellschaft› offiziell gebildet werden können.“[12]
Etwas anders stellte sich die Situation 1923 dar: Da sich die Gesellschaft nicht so entwickelt hatte, wie 1912 erhofft und die versuchte Konsolidierung im Jahr 1923 sich als nicht möglich erwiesen hatte, war die Neugründung und insbesondere die Übernahme der Gesellschafts-Leitung Rudolf Steiners letzter Versuch, um doch noch zu erreichen, was von Anfang intendiert war:
„Ich will auf die Kraft bauen, die es mir ermöglicht, ‹Geistesschüler› auf die Bahn der Entwickelung zu bringen. Das wird meine Inaugurationstat allein bedeuten müssen“.[13]
„Eine geistige Bewegung in Europa ins Leben zu rufen“ und zwar „eine solche Bewegung, die an den abendländischen Okkultismus und ausschließlich an diesen anknüpft und diesen fortentwickelt.“[14]
Der Menschheit die notwendige Verbindung zu ihren geistigen Ursprüngen sowie zeitgenmässe neue Mysterien zu ermöglichen: An diesen Intentionen Rudolf Steiners hatte sich auch 1923/24 nichts geändert. Wie er schon 1905 ausführte ging es darum, dass spirituelle Vereinigungen auf bruderschaftlicher (menschlicher) Basis entstehen:
„Vereinigung bedeutet die Möglichkeit, dass ein höheres Wesen durch die vereinigten Glieder sich ausdrückt. Das ist ein allgemeines Prinzip in allem Leben. Fünf Menschen, die zusammen sind, harmonisch miteinander denken und fühlen, sind … nicht bloß die Summe aus den fünf. … Eine neue, höhere Wesenheit ist mitten unter den fünfen, ja schon unter zweien oder dreien. ‹Wo zwei oder drei in meinem Namen vereinigt sind, da bin ich mitten unter ihnen.› Es ist nicht der eine und der andere und der dritte, sondern etwas ganz Neues, was durch die Vereinigung entsteht. … So sind die menschlichen Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten, in welche sich höhere geistige Wesenheiten herniedersenken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die Glieder des Körpers wirkt. … Zauberer sind die Menschen, die in der Bruderschaft zusammen wirken, weil sie höhere Wesen in ihren Kreis ziehen. … Der Zukunft obliegt es, wieder Bruderschaften zu begründen, und zwar aus dem Geistigen, aus den höchsten Idealen der Seele heraus.“[15]
So setzte er 1923 „letzte Hoffnung“[16] darauf, diese Intentionen nun nach der Weihnachtstagung im gesellschaftlichen Zusammenhang „durchführen“[17]zu können.
Verpasste Möglichkeiten?
2001/2002 – die säkulare Wiederkehr der Gründung der „Anthroposophischen Gesellschaft“
Geht man wie Rudolf Steiner davon aus, dass die eigentliche Gründung der „Anthroposophischen Gesellschaft“ bereits im Jahr 1902 stattfand, wären im 33-Jahres-Rhythmus (1935, 1968 und 2001) Erneuerungsmöglichkeiten gegeben gewesen. Stattdessen finden sich in diesen Jahren Kulminationspunkte der grossen Gesellschaftskonflikte:
- Im Jahr 1935 kulminierte der bereits unmittelbar nach Rudolf Steiners Tod ausgebrochene Gesellschaftskonflikt in den Ausschlüssen von Ita Wegman und Elisabeth Vreede aus dem Vorstand, den Ausschlüssen einiger Einzelpersonen sowie der gesamten holländischen und englischen Landesgesellschaft aus der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Darüber hinaus wurden Statuten-Änderungen beschlossen, „um die Statuten den Prinzipien weitgehend anzugleichen“[18], was allerdings nicht den Tatsachen entsprach: So wurde insbesondere die Position des 1. Vorsitzenden gegenüber den anderen Vorständen gestärkt[19], diesem das alleinige Recht zur Aufnahme von Mitgliedern übertragen und insbesondere für Vorstandserweiterungen das Kooptions-Prinzip eingeführt. Von all dem konnte in der Konstitution der Weihnachtstagungs-Gesellschaft nicht die Rede sein.
- Im Jahr 1968 beschloss der Vorstand, ab sofort die von der Nachlassverwaltung herausgegebenen Bücher (insbesondere Schriften und Vorträge Rudolf Steiners) nicht weiter zu verleugnen und diese auch im Goetheanum zu verkaufen. Damit wurde ein 20-jähriger Boykott der Nachlassverwaltung aufgehoben, ohne dass jedoch der Nachlassstreit angemessen aufgearbeitet worden wäre. Zudem wurde ein neuer jahrelanger Konflikt erzeugt, da Herbert Witzenmann den Mehrheitsbeschluss nicht mittragen wollte und er seine Position öffentlich gegenüber der Mitgliedschaft vertrat. Dies führte erneut zu Spannungen und Spaltungen in der Gesellschaft. Näheres hierzu siehe Fussnote.[20]
- Im Jahr 2001 – nach fast 40 Jahren – konnte die Existenz des Konstitutionsproblems von Vorstandsseite nicht weiter geleugnet werden. Davon zeugte die Veröffentlichung des sogenannten „Mannheimer Ergebnisses“[21] als Zwischenresultat einer Arbeitsgruppe, die aus Funktionären sowie Mitgliedern bestand, die sich in der Konstitutionsfrage engagiert hatten. Allerdings wurden alle Hoffnungen auf eine gemeinsame weitere Vorgehensweise durch den Alleingang des Vorstandes zunichte gemacht, als dieser ohne jede Absprache und entgegen dem vereinbarten Vorgehen einseitig die weitere gemeinsame Arbeit verunmöglichte und einen eigenen Weg zu Lösung des Problems einschlug.[22] Dieser führte zu weiteren Konflikten und mehrjährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Eine wirkliche Lösung des Konstitutions-Problems wurde jedoch nicht erreicht. Letztlich hat der Vorstand durch unkluges Agieren die Streitigkeiten provoziert, die Gerichtsprozesse vorhersehbar verloren und anschliessend mit einer weiteren Unwahrheit behauptet, das Gericht habe festgestellt, aufgrund einer konkludenten Fusion sei die AAG mit der WTG identisch.[23] Letztere Ansicht wird auch heute noch vertreten – tatsachenwidrig wider besseren Wissens.[24]
Eine Aufarbeitung all dieser Konflikte und Gesellschaftskatastrophen steht nach wie vor aus. Insbesondere die (negative) Bedeutung des Rekonstitutionsversuches von 2001/2002 ist in seiner Tragweite bisher zuallermeist kaum realisiert worden.
Allein schon die Bedeutung der Tatsache, dass die Möglichkeit vollkommen verpasst wurde, bewusst und aktiv an die ursprünglichen geistigen Impulse zur Gesellschaftsgründung anzuknüpfen, dürfte schwerwiegend sein: Wurden diese damit für lange Zeit endgültig vertan? Konnte damit der „Dämon dieses Zeitalters“ Herrschaft über die weitere Entwicklung erlangen? Vergleichbar mit dem, was Rudolf Steiner zu dem Nichtergreifen der liberalen Ideen im 19. Jahrhundert ausführte? „Denn nachher ist nichts mehr zu erreichen auf demjenigen Wege, auf dem das in dem genannten Zeitraume erreichbar gewesen wäre. Nachher ist nur durch völliges Erwachen im geisteswissenschaftlichen Erleben etwas zu erreichen. So hängen die Dinge historisch in der neueren Geschichte zusammen.“[25] Noch deutlicher kommt das an anderer Stelle zum Ausdruck:
„Wenn so etwas [wie die Spiritualisierung der Menschheit] – da die Menschheit in der neueren Zeit auf Freiheit gestellt werden muss – aus dem freien Menschenwillen heraus unterlassen wird, so sinkt die Waagschale auf die andere Seite hinunter. Dann entlädt sich das, was auf spirituellem Wege hätte erreicht werden können, durch das Blut. Dann entlädt sich das auf eine, ich möchte sagen, überphysische Weise. Es ist nur das Gleichstellen der Waage, was wir in unserer katastrophalen Zeit erleben. Die Menschheit, die zurückgewiesen hat die Spiritualisierung, muss in die Spiritualisierung hineingezwungen werden. Das kann durch eine physische Katastrophe [damals der erste Weltkrieg] geschehen.“[26]
Lassen wir die weitere Beurteilung dieser Ereignisse und die heutige Bedeutung zunächst offen.
Die säkulare Wiederkehr des Bauimpulses.
Einen genauen ursprünglichen Zeitpunkt für den Bauimpuls zu finden ist nicht einfach. Da der Bau zunächst in München entstehen sollte, wurde dort auch der erste Johannesbau-Verein im Jahr 1910 gegründet. Im Oktober 1912 war Rudolf Steiner erstmals in Dornach und erkundete die Umgebung des ihm angebotenen Geländes. Die endgültige Entscheidung für Dornach wurde 1913 gefällt, die Grundsteinlegung fand am 20. September 1913 statt und 2 Tage später wurde der Dornacher „Johannesbau-Verein“ gegründet. Innerhalb dieses Zeitraumes liegt die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Köln 1912. Insofern bietet sich dieses Jahr für eine weitere Untersuchung an. Im 33er-Rhythmus ergibt sich die Folge: 1912 – 1945 – 1978 – 2011/12 (Ergänzungen für die nachfolgend angeführten Ereignisse sind willkommen).
- Im Jahr 1945 begann die Eskalation des Nachlassstreites. Marie Steiner gab die Übertragung ihrer Rechte an den 2 Jahre zuvor gegründeten Nachlassverein bekannt. „Eine Bombe schlägt ein“[27], so überschreibt Lorenzo Ravagli das entsprechende Kapitel. Die damit beginnenden und vor allem eskalierenden Auseinandersetzungen prägten Jahrzehnte der Gesellschaftsgeschichte mit Auswirkungen, die auch heute noch zu spüren sind. Eine Aufarbeitung ist nicht erfolgt, die einzige mir bekannte einigermassen umfassende Darstellung findet sich in dem zitierten Werk von Lorenzo Ravagli.
- 1978: Beginnende Kulmination des Interesses insbesondere der Jugend an der Anthroposophie. Blüte der Jugendsektion, der Seminartätigkeiten und der Ausbildungsstätten – bis in die 80er/90er Jahre.
- 2011: An die Stelle einer Erinnerung an die ursprünglichen Impulse trat wieder ein Gesellschaftskonflikt. Aufgrund eines Abwahlantrages, der bereits Monate zuvor bekannt war, hatte der Vorstand beschlossen, diesem zuvor zu kommen und die Amtszeit der Vorstände zukünftig auf 7 Jahre zu begrenzen. Insbesondere von Paul Mackay und Bodo von Plato wurden hehre Ziele und Absichten vorgebracht. So sollten „… die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden“ und „Es geht darum, dass wir ein neues soziales Feld entwickeln. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder mehr einbezogen werden.“ sowie „Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht“, erwiesen sich schon durch das nachfolgende Verhalten der Leitung als leere Versprechen. Als geradezu taktisches Lügengebäude offenbarten sich diese durch Paul Mackays öffentliches Eingeständnis, als er zur Begründung seines Antrages zur Aufhebung dieser Amtszeitbeschränkung vorbrachte, dass deren Einführung 2011 lediglich eine (mögliche Über-)Reaktion auf den damaligen Abwahlantrag gewesen sei! Des Weiteren führte er aus, dass schon regelmässig eine Besinnung auf die Vorstandstätigkeit erfolgen sollte, allerdings ohne die Mitgliedschaft einzubeziehen, denn nur im Kreis der Goetheanum-Leitung und der Konferenz der Generalsekretäre sei eine Beurteilung der Vorstandstätigkeit möglich![28]
Die säkulare Wiederkehr der Weihnachtstagung 2022/23
Mit Blick auf die Weihnachtstagung ergibt sich die Jahresfolge: 1923 – 1956 – 1989 – 2022/23.
Die Jahre 1956 und 1989 sind offensichtlich keine markanten Krisenjahre im gesellschaftlichen Zusammenhang. Der Fall der Mauer 1989, die damit verbundene Auflösung des sozialistischen Experimentes im Osten traf die anthroposophische Gemeinschaft unvorbereitet. Die Versuche freier Initiativen, die allesamt ihren Ursprung nicht im gesellschaftlichen Zusammenhang hatten, Elemente der Dreigliederung in die Neugestaltung der sich auflösenden Staatsverhältnisse einzubringen, blieben letztlich erfolglos und so konnten sich die westlichen Hegemonieambitionen durchsetzen. Es ist offensichtlich, dass heute, ca. 33 Jahre später, wieder eine Zuspitzung stattfindet – diesmal weltweit. Insbesondere mit Blick auf einige aktuelle Verlautbarungen der medizinischen und sozialwissenschaftlichen Sektion[29] drängt sich die Frage auf, ob die Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Hochschule die aktuelle Weltlage realistisch einschätzt.
Noch steht das Ereignis 99 Jahre Weihnachtstagung vor uns. Sind damit noch alle Möglichkeiten offen?
Nun wird es darauf ankommen, zunächst die tatsächlichen Impulse und Absichten, die mit der Weihnachtstagung und der Neugründung von Gesellschaft und Hochschule verbunden waren, herauszuarbeiten.
Fazit
„Die Weisheit liegt nur in der Wahrheit“
Motto der Anthroposophischen Gesellschaft
Es ist offensichtlich ein Symptom im Zusammenhang der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, sich an die ursprünglichen Impulse nicht erinnern zu wollen. Stattdessen kulminierten ausgerechnet an etlichen entscheidenden Zeitpunkten des 33-Jahresrhythmus die Gesellschaftskonflikte mit den damit verbundenen Ausgrenzungen und Spaltungen, wodurch den Widersachermächten für ihr Wirken Tür und Tor geöffnet wurde. Man kann sich fragen, ob nach all den hier beschriebenen Gegebenheiten nun mit der säkularen Wiederkehr der Weihnachtstagung – dem letzten Versuch Rudolf Steiners, seine Aufgabe, seine Mission für die Menschheitsentwicklung doch noch erfüllen zu können – auch für uns die allerletzte Möglichkeit gegeben sein wird, sich die ursprünglichen Impulse zu vergegenwärtigen und zu ergreifen, was noch ergriffen werden kann. Ohne eine zumindest anfängliche Aufarbeitung der Gesellschaftsgeschichte – die ja gleichzeitig die Geschichte der Entwicklung der Anthroposophie ist – wird das jedoch kaum möglich sein.
Die Erinnerung an die Weihnachtstagung und die Besinnung auf die damit verbundenen Impulse und Absichten werden nur dann fruchtbar werden können, „wenn auf Grundlage der Erkenntnis der Mangelhaftigkeiten … also der konkreteren Erkenntnis desjenigen, was mangelhaft ist, zu einer Gestaltung des Positiven geschritten wird.“[30] (Rudolf Steiner im Zusammenhang mit dem Konsolidierungsversuch der Gesellschaft am 26. Febr. 1923).
Das Mysteriengeschehen der Weihnachtstagung war keineswegs ein isoliertes Ereignis für die Anthroposophische Gesellschaft, es war ein Menschheitsereignis, der letzte Versuch, aus den „Zeichen der Zeit“ eine spirituelle Vereinigung von Menschen zu bilden, mit der eine Erneuerung der Mysterien hätte möglich werden können, „für den Fortschritt der Menschenseelen, für den Fortschritt der Welt.“[31]
Jeder, der sich mit Rudolf Steiner und der Anthroposophie verbunden erlebt, kann sich hier angesprochen fühlen, initiativ zu werden, auch jenseits des gesellschaftlichen Zusammenhangs.
Thomas Heck, 6. Jan. 2022
[1] GA 225, S. 166.
[2] Hierzu insbesondere GA 180, Vorträge 1-4.
[3] Justus Wittich, AWW 12/2021, S. 3.
[4] Eine ausführliche Literaturliste in Jens Göken, „Das Gesetz der 33 Jahre“, Gegenwart Nr. 2 / 2011. Frank Spaan, „Über den 33 Jahres-Rhythmus“, Privat-Druck, Bezug: postfs@protonmail.com.
[5] GA 222, 1989, S. 18, 11. März 1923.
[6] Siehe z.B. Internetseite www.goetheanum.org und rosa Info-Heft für neue Mitglieder.
[7] AWW 9/19, S. 3.
[8] Der „Johannesbau“ sollte ursprünglich in München entstehen. Dem standen jedoch verschiedene Widerstände entgegen, sodass diese Absicht 1913 aufgegeben wurde.
[9] Ohne dem Ergebnis der Kolloquiumsarbeit vorgreifen zu wollen kann aber gesagt werden, dass in dieser Frage bei den Teilnehmern ein breiter Konsens herrscht.
[10] GA 238, S. 16, 5. Sept. 1924.
[11] GA 260a, S. 94, 18. Jan. 1924.
[12] GA 28, 1982, S. 309.
[13] Brief vom 16. Aug. 1902 an Wilhelm Hübbe-Schleiden, hier zitiert nach GA 264, S. 19.
[14] Aus dem Gespräch zwischen Marie von Sivers und Rudolf Steiner am 17. Nov. 1901, GA 254, 1986, S. 48.
[15] GA 54, 1983, S. 192f. und GA 265, 1987, S. 122.
[16] GA 259, 1991, S. 865. Aus einem Brief von Rudolf Steiner an Marie Steiner
[17] GA 260a, 1987, S. 183.
[18] Nachrichtenblatt Nr. 11/12, 17. März 1935.
[19] Der 1. Vorsitzende wurde quasi allmächtig und bestimmte die Vollmachten der übrigen Vorstandsmitglieder – und konnte sie diesen auch entziehen, siehe §13 der damaligen Statuten. Nachrichtenblatt 11/12, 17. März 1935.
[20] Lorenzo Ravagli, Selbsterkenntnis in der Geschichte, Band 1, Glomer.com, o.J.
[21] Nachrichtenblatt Nr. 20, 20. Mail 2001.
[22] Justus Wittich, „Konstitutionsgruppe als wichtiger Wegbereiter“, Nachrichtenblatt 42/2002.
[23] „Mythen der Konstitutions-Frage: ‚Die Fusion durch konkludentes Handeln‘“, https://wtg-99.com/mythos-fusion.
[24] Justus Wittich, „Stärkung der Hochschule in den Statuten“ in AWW 1-2/2014.
[25] GA 185, 1982, S. 95.
[26] 174a, 1985, S. 230f.
[27] Lorenzo Ravagli, Selbsterkenntnis in der Geschichte, Band 1, Glomer.com, o.J.
[28] Nur im Internet: https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunikation/GV_2019_Antraege.pdf (letzter Zugriff: 28.12.2021).
[29] Gemeint sind hier die diversen Positionierungen zu den Corona-Impfungen und die Äusserung G. Häfners, Deutschland habe unbewusst die Dreigliederung gewählt.“ („Das Goetheanum“, 15. Okt. 2021).
[30] GA 259, S. 377.
[31] Zitate aus dem Eröffnungsvortrag der Weihnachtstagung 24. Dez. 1923, GA 260.
von Thomas Heck | Mai 15, 2020 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Liebe Freunde,
es ist im Moment kaum möglich, mit der Entwicklung der Ereignisse – und leider auch der Bedrohungen – die durch das politische Handeln der Verantwortlichen erzeugt werden, mitzukommen. Die Veröffentlichung einer umfangreichen und wohl sehr zutreffenden Analyse aus dem Bundesinnenministerium offenbart, mit wie wenig Überblick und vor allem mit fehlender Risikoabschätzung Massnahmen ergriffen wurden, die nach allem, was jetzt bekannt ist, weit mehr Schäden anrichten – auch an Menschenleben – als durch die Massnahmen vermeintlicher Nutzen erzeugt wurde. Anstatt sich nun der wirklich bestehenden Probleme zuzuwenden, denkt man über marginale Lockerungen nach. Offensichtlich man bestrebt, die Massnahmen so weit und so lange als möglich gesichtswahrend aufrecht zu erhalten. Der Umgang mit dem geleakten Dokument aus dem Bundesinnenministerium spricht Bände: Auf den brisanten Inhalt wird nicht eingegangen, sehr wohl aber auf das angebliche Fehlverhalten des inzwischen beurlaubten Mitarbeiters.
Ein Artikell von Lorenzo Ravagli zu dem Vorgang um das Dokument aus dem BMI:
https://anthroblog.anthroweb.info/2020/corona-virus-menschheit-am-scheideweg/
Rundbrief Nr. 23: www.wtg-99.com/Rundbrief_23
Sie werden alle bereits überflutet sein mit Informationen und Hinweisen auf Videos und Veröffentlichungen und man kann nicht alles wahrnehmen. Dennoch möchte ich einige Hinweise geben:
Ein Artikel von Johannes Mosmann: „Corona – Menschheit am Scheideweg“
https://www.dreigliederung.de/files/download/essays/2020-05-johannes-mosmann-corona-virus-menschheit-am-scheideweg.pdf
Ein Beitrag von Peter Selg thematisiert vor allem die entstehenden totalitären Entwicklungen im historischen Kontext:
https://kernpunktecom.files.wordpress.com/2020/05/kernpunkte_no._6_2020-1.pdf
Ein Ärztin bringt vieles auf den Punkt:
https://www.youtube.com/watch?v=YKKe_t20ml0
Die Parteigründung von dem Arzt Bodo Schiffmann www.widerstand2020.de hat nun vor allem damit zu kämpfen, dass sie von Anmeldungen hoffnungslos überrannt (mehr als 100.000 Anmeldungen in ca. 14 Tagen) und natürlich auch auf allen Ebenen angegriffen wird. Widerstand ist im Moment vielleicht wirklich angesagt und man kann nur hoffen, dass dieser Ansturm irgendwie bewältigt werden wird. Für unterstützungswürdig halte ich persönlich Bodo Schiffmann in jedem Fall:
https://kenfm.de/dr-bodo-schiffmann/
Mit herzlichen Grüssen
Thomas Heck
von Thomas Heck | Apr 9, 2020 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Was Greta Thunberg nicht geschafft hat («I want to panic you»), für das Corona-Virus war es kein Problem: Die Welt in Panik, in Angst und Schrecken zu versetzen. Unvorstellbares ist eingetreten: Grosse Teile der Weltbevölkerung unterliegen derzeit Ausgangsbeschränkungen und die Weltwirtschaft ist in weiten Teilen zum Stillstand gekommen. Inzwischen kommen aber auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit der offiziellen Berichterstattung auf und es wird gefragt, ob mit dieser sogenannten Pandemie und ihren Folgen möglicherweise auch ganz andere Interessen verfolgt werden. ….
Weiter im Rundbrief Nr. 21
Inhalt
– Corona und der Kampf um die Deutungshoheit
– Irreführende Berichterstattung
. Erfolgreiche Propaganda
– Weltregierung und “Neue Weltordnung”
Diverse Links zu interessanten Informations-Seiten, Petitionen und interessanten Videos finden Sie unter www.wtg-99.com/corona
Hinweis: Die Internetseite von der Rechtsanwältin Beate Bahner war zum Zeitpunkt des Versandes nicht erreichbar. Auf derartige Zwischefälle und Löschungen von Seiten wird auch von Swiss Propaganda Research (www.swprs.org/covid-19-hinweis-ii/) hingewiesen!
von Thomas Heck | Mrz 29, 2020 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Der aktuelle Rundbrief enthält einen Beitrag zum Todestag Rudolf Steiners am 30. März, der dieses Jahr wie 1925 auf einen Monat fällt.
von Thomas Heck | Dez 1, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, Steiner Studies
Rundbrief zur Anthroposophie von Friedwart Husemann vom 1. Dezember 2019
Liebe Freunde,
Sie können sich an der Kontroverse um die Steiner Studies beteiligen. Hier der Link:
Steiner Studies
Rudolf Steiner hat über Welt, Erde und Mensch, aber auch zur Anthroposophischen Bewegung, zur Soziologie der Anthroposophischen Gesellschaft und zur Gegnerfrage sehr ausführlich sich geäußert. Beispielweise wollte er, dass man Gegner moralisch beurteilt, wenn sie R. Steiner verleumdeten oder Lügen verbreiteten, und er wollte, dass man dieses Urteil öffentlich ausspricht (GA 259, siehe „Rudolf Steiner zur Gegnerfrage“ unter „Dokumentation“ im obigen Link). Meiner Meinung nach ist es so, dass im Falle von Helmut Zander dieser Ratschlag R. Steiners angewendet werden sollte.
Allerdings leben wir heute in einer Zeit, wo moralische Urteile als anstößig empfunden werden. Darüber hinaus hat sich in leitenden Kreisen der Anthroposophischen Gesellschaft die Meinung ausgebreitet, dass es die Gegner so wie damals bei R. Steiner nicht mehr gibt. Ich bin dieser Meinung nicht. Wir können aber in Ruhe warten, bis die Tatsachen selber sprechen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Friedwart Husemann
Dr. med. Friedwart Husemann
Internist – Homöopathie
Anthroposophische Medizin (GAÄD)
Poghausener Str. 46
26670 Uplengen
Tel: 04956 4047007
Fax: 04956 4047006
www.husemannpraxis.de
friedwart.husemann@gmx.de
von Thomas Heck | Nov 27, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft, Steiner Studies
Sehr geehrte Frau Sandtmann,
dieser offene Brief – als Reaktion auf Ihre Erwiderung auf den Brief des Dresdner Zweiges – geht stellvertretend an Sie, im Grunde ist von den folgenden Ausführungen die gesamte weltweite Gesellschafts-Leitung betroffen, insbesondere als Mitglieder der Freien Hochschule.
Es ist wirklich beeindruckend, wie seitens der Leitenden in unserer Gesellschaft durch die Beherrschung der Kommunikation auf sachlich-kritische (im Sinne des terminus-technikus, wie Sie es formuliert haben) Stimmen aus der Mitgliedschaft häufig gar nicht, ansonsten manipulativ und extrem einseitig reagiert wird. So auch auf die – im besten Sinne – kritischen Reaktionen auf die Mitwirkung namhafter und leitender Persönlichkeiten aus der anthroposophischen Gesellschaft an der Initiative der „Steiner Studies“.
Auf einen wirklichen Dialog mit den eigenen Mitgliedern lässt man sich nicht ein, sehr wohl aber mit unwissenschaftlich agierenden Gegnern Rudolf Steiners und der Anthroposophie.
Im Einzelnen zum aktuellen Vorfall:
- So, wie Sie aus dem Brief des Dresdner Zweiges zitieren, entsteht ein einseitiges Bild und es wird nicht deutlich, was die 20 Unterzeichner wirklich zum Ausdruck bringen. Unter den Unterzeichnern sind gewiss auch Hochschulmitglieder, die ihr „Repräsentant-Sein“ ernst nehmen und aus Sorge über die Entwicklungen in unserer Gesellschaft und aus einer gelebten Verantwortung gegenüber Rudolf Steiner, der Anthroposophie und der Hochschule sich zu Wort gemeldet haben.
- Durch Weglassen der zentralen Argumente – insbesondere dem Hinweis, dass seitens der Gesellschafts- und der Hochschulleitung zu den unwissenschaftlichen und diffamierenden Äusserungen der Initiatoren der „Steiner Studies“ bisher nie Stellung bezogen wurde – wird verhindert, dass sich der Leser ein eigenständiges Urteil bilden kann.
- Sie nennen die Namen der Unterzeichner dieses offenen Briefes nicht. So wird nicht sichtbar, dass zumindest drei der Unterzeichner Mitglieder im Vorstand des Arbeitszentrums Ost sind.
- Sie führen aus, dass die „Steiner Studies von der AGiD weder veranlasst noch beauftragt“ wurden. Dadurch entsteht der Eindruck, dies sei in dem Brief behauptet worden. Ein derartig absurder Vorwurf wurde jedoch gar nicht erhoben. Das kann der Leser aber nicht erkennen und muss das Gegenteil annehmen.
- Bemerkenswert ist, dass Sie Näheres über die Intentionen der „Steiner Studies“ wissen und so etwas darüber aussagen können, wie die „kritische Steiner-Forschung“ von den Initiatoren wirklich gemeint sei. Woher wissen bzw. woraus schliessen Sie das und wie kommen Sie dazu, diese Initiative zu verteidigen?
- Wie Sie zu dem Urteil kommen, dass es sich bei den „Steiner Studies“ um eine wirklich „wissenschaftliche Zeitschrift“ handeln wird, ist nicht nachzuvollziehen, da – soweit bekannt – eine Ausgabe dieser Zeitschrift bisher nicht einmal vorliegt.
- Nach C. Clements Ansicht führen die Forschungsmethoden Rudolf Steiners nicht zur Erkenntnis einer wirklichen geistigen Welt und auch nicht zu außerhalb des (alltäglichen) Bewusstseins des Menschen existierenden geistigen Wesen. Steiner begegne in seiner Geistesforschung nur sich selbst (siehe z.B. Frank Linde, Die Drei 11/2015). Nach allem, was von und über C. Clement bekannt ist, urteilt er über die Anthroposophie und die Schriften Rudolf Steiners, ohne selber sich um den anthroposophischen Schulungsweg bemüht zu haben. Denn wenn man Rudolf Steiner und den von ihm formulierten Voraussetzungen ernst nimmt, kann man C. Clements Urteilen keine Berechtigung zusprechen: „ … doch nimmt die Leitung der Schule für sich in Anspruch, dass sie von vornherein jedem Urteile über diese Schriften die Berechtigung bestreitet, das nicht auf die Schulung gestützt ist, aus der sie hervorgegangen sind. Sie wird in diesem Sinne keinem Urteil Berechtigung zuerkennen, das nicht auf entsprechende Vorstudien gestützt ist, wie das ja auch sonst in der anerkannten wissenschaftlichen Welt üblich ist.“ (§8 der Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft). So stellt sich auch in diesem Zusammenhang die Frage, wie Sie sicher sein können, dass es sich bei den „Steiner Studies“ wirklich um eine „wissenschaftliche“ Zeitschrift handeln wird? Und wie kommen Sie zu der Annahme, dass jemand wie H. Zander im positiven Sinne zu kritischer Wissenschaftlichkeit gegenüber Rudolf Steiner neigen könnte, wenn er sich wie folgt äussert:
„Kritiker und Wissenschaftler haben sich auch gefragt, welche psychische Disposition Steiner besass, ob er, polemisch gefragt, ›geisteskrank‹ war oder, seriöser, an Schizophrenie litt. … Oder nahm er vielleicht doch Drogen? Mit dem Schnupftabak, den er liebte, könnte er auch Kokain, den ›Schnee‹ wie es in seinen Briefen heisst, zu sich genommen haben, vielleicht bewusst, vielleicht auch ohne es zu wissen. Halluzinogene Mittel mögen, wenn er sie denn nahm, einzelne Erfahrungen erklären, aber seine Beschäftigung mit meditativen Techniken über zweieinhalb Jahrzehnte geht darin nicht auf.“
- Im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt stellt sich die Frage, inwieweit Sie (und Ihre Kollegen) – soweit Sie Hochschulmitglieder sind – in Ihrem Verhalten und in Ihrer Argumentation gegenüber den Initiatoren und deren Werken selber der Bedingung der „Repräsentanz für die anthroposophische Sache“ insbesondere als Hochschulmitglieder mit Leitungsaufgaben und ggf. als Lektoren – gerecht werden, wenn Sie sich derartig für C. Clement, H. Traub, H. Zander u.a. einsetzen, obwohl es sich offenkundig um Gegner der Anthroposophie und Rudolf Steiners handelt?
- Es ist kaum anzunehmen, dass Rudolf Steiner ein derartiges Verhalten von Hochschulmitgliedern geduldet hätte, ein Ausschluss aus der Hochschule wäre wohl spätestens jetzt die Folge gewesen. Sich in dieser Art und Weise für die Gegner der Anthroposophie und Rudolf Steiners einzusetzen, kommt im Grunde einem Selbstausschluss gleich, wohl nicht rechtlich, jedoch moralisch. Da dieses Verhalten aber gerade aus der Leitung der Gesellschaft heraus erfolgt und von der Hochschulleitung und den Sektionsleitungen geduldet – wenn nicht sogar begrüsst – wird, müssten auch alle diejenigen, die dieses Verhalten decken und beschweigen, nach den selbst vertretenen Bedingungen der Hochschulmitgliedschaft aus dieser ausgeschlossen werden. So werden diese Bedingungen zur Hochschulmitgliedschaft immer wieder eingefordert – selber aber hält man sich nicht daran!
- Wer der Ansicht ist, man könne mit C. Clement oder H. Zander auf geisteswissenschaftlichem Niveau fruchtbar zusammenarbeiten, müsste dies angesichts der vorliegenden fundierten kritischen Auseinandersetzungen mit deren Veröffentlichungen begründen und belegen können. Es scheint aber evident zu sein, dass sich gerade diejenigen, die meinen, sich auf einen Dialog mit C. Clement u.a. einlassen zu müssen, einen solchen mit den im besten wissenschaftlichen Sinne kritischen Mitgliedern vermeiden. So ist z.B. von einer Auseinandersetzung von J. Schieren oder W.-D. Klünker mit F. Linde oder L. Ravagli nichts bekannt. Ebenso existieren keine Stellungnahmen z.B. seitens der Hochschulleitung. Auf die Unvereinbarkeit mit dem selbst vertretenen Repräsentanz-Anspruch wurde bereits hingewiesen.
Ein sachlicher Dialog im Sinne einer gemeinsamen Erkenntnisbemühung ist mehr als überfällig. Aus Ihren Ausführungen ist nicht erkenntlich, ob dazu eine Bereitschaft besteht. Und um eine Personaldebatte geht es nicht – es geht um Erkenntnisfragen! Werden wir es noch erleben, dass die Leitung der Gesellschaft und der Hochschule ihre Aufgabe und Verantwortung ergreift, um endlich Stellung zu beziehen und sich auf einen inhaltlichen Dialog mit den Mitgliedern einzulassen?
Mit freundlichem Gruss
Thomas Heck, Dornach, den 22. November 2019, Kontakt: thomas@lohmann-heck.de
von Thomas Heck | Sep 4, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Samstag, den 21. September 2019, 9:30 – 18 Uhr
Themen
- Die Stellung des Weihnachtstagungsgeschehens in der Menschheitsentwicklung
- Rudolf Steiners Mission
- Rudolf Steiners Intentionen im Hinblick auf die Weihnachtstagung
- Was zur Weihnachtstagung und zur Neukonstituierung der Gesellschaft führte
- Zur Form: Wie wollte Rudolf Steiner die einheitliche Konstituierung realisieren?
- Zur Identität: in welchem Zusammenhang steht die AAG mit der Weihnachtstagungs-Gesellschaft?
Seminaristische Arbeit mit Thomas Heck
Anmeldung: thomas@lohmann-heck.de oder 061 / 599 16 47
Kostenbeteiligung: 80 CHF, Ermäßigung möglich.
Maximal 20 Teilnehmer
Ort: Veranstaltungsraum der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz, Oberer Zielweg 60, 4143 Dornach.
von Thomas Heck | Apr 1, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Pressemitteilung der Goetheanum-Leitung
Im Rahmen des Projektes „Goetheanum in Entwicklung“ und im Zuge der zunehmenden Unzufriedenheit vieler Mitglieder mit den Entwicklungen am Goetheanum ist, nun ein professionelles Beschwerdemanagement für Unmutsäusserungen und Kritik an der Leitung des Goetheanums, der Hochschule und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft eingerichtet worden. Besonderer Wert wurde dabei auf das Schutzbedürfnis von Mitgliedern gelegt, die Kritik oder Beschwerden vorbringen möchten.
Ab sofort können entsprechende Beschwerden schriftlich an das Goetheanum (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Abt. Beschwerdemanagement , Hügelweg 45, 4143 Dornach oder per Email an beschwerden@goetheanum.ch) verschickt werden. Es wird absolute Diskretion zugesichert. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass erhaltenen Briefe sofort ungeöffnet und ungelesen einer zertifizierten Aktenvernichtung zugeführt werden. Damit ist allen Beteiligten optimal gedient: Der Beschwerdeführer hat sich unbehindert und frei äussern können ohne mit negativen Folgen wie z.B. schlechtem Ansehen oder der Kritik, kritisiert zu haben, rechnen zu müssen. Auch der Beschwerde bzw. der Kritik als solcher ist absolute Diskretion zugekommen, indem weiter niemand von ihr etwas erfährt und sich so darüber auch niemand, insbesondere die Leitung des Goetheanums, ärgern oder angegriffen fühlen muss. Durch eine zertifizierte Software ist sichergestellt, dass die Emails nach Eingang sofort gelöscht werden und auch keine Sicherungskopien erstellt werden. Für dringende telefonische Beschwerden wurde eine automatische Annahme (7 x 24 Stunden Bereitschaft) eingerichtet (061 / 706 99 99). Auch hier wurde sichergestellt, dass der Anrufer ungestört (vor allem ungehört) ausführlich sprechen kann. Aus den bereits genannten Diskretionsgründen wurde die Aufnahmefunktion des Anrufbeantworters ausser Betrieb gestellt.
So werden kritische Zuschriften an die Leitung der Gesellschaft auch in Zukunft nicht beantwortet. Der wesentliche Fortschritt besteht nun darin, dass man nicht wie bisher unangemessenes Verhalten der Leitung vermuten kann, da diese definitiv nichts von der Zuschrift erfährt und frei nach dem Grundsatz: „Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss“ nach Gutdünken und ungestört ihren Intentionen nachgehen kann.
Mitglieder, die diesem Verfahren keine positive Seite abgewinnen können, werden ausdrücklich auf die neu vorgestellten Medikamente des Sofimed® Heilmittellabors hingewiesen, besonders Egalodoron® und Ovis silens comp®[1] werden gewiss hervorragend Abhilfe schaffen. Empfehlenswert ist auch die folgende Meditationsformel, mit der evtl. bestehendes Unbehagen wirkungsvoll beseitigt werden kann: „Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.“
Die Goetheanum-Leitung, 1. April 2019
[1] Nähere Angaben zu den Medikamenten erscheinen in einer Pressemitteilung der Sofimed® Heilmittel AG in „Ein Nachrichtenblatt“.
von Thomas Heck | Mrz 26, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Freitag, 23 März 2018, Generalversammlung im großen Saal, auf der Tagesordnung: Aussprache zu den Anträgen und Anliegen. In eindrücklichen Worten, mit strenger Stimme, ermahnte der Versammlungsleiter Florian Oswald die ca. 650 anwesenden Mitglieder, sie mögen sich vergegenwärtigen, in welchem Raum sie sich befinden. Dabei wies er demonstrativ auf die Deckenmalerei und die Fenster. Es sei die Würde des großen Saales zu berücksichtigen, wenn man hier spricht. Durch die von vielen Mitgliedern empfundene unangemessene und oberlehrerhafte Ermahnung entstand eine beklemmende Stimmung im Saal, in die hinein dann die Regeln für die Aussprache genannt wurden: maximal 3 Minuten Redezeit, er habe das Recht zu unterbrechen und er wolle keine Mitglieder sehen, die sich zum Sprechen an der Bühne anstellen. Man solle sich melden und er würde auswählen, wer sprechen kann. Sowohl der Inhalt als auch die Art und Weise, wie Florian Oswald selber sprach, standen im krassen Widerspruch zur Würde des Saales. Die Mitglieder nahmen die Massregelungen hin, lediglich ein Zwischenruf „was erlauben Sie sich?“ brachte die Situation auf den Punkt, blieb jedoch ohne Reaktion. In der Folge, und das dann besonders am Sonntagvormittag, sollte sich zeigen, dass die Würde durch die Mitgliedschaft gewahrt blieb, einzig aus der Goetheanum-Leitung und dem Kreis der Generalsekretäre bzw. der Landesvertreter fielen einige aus der Rolle, indem sie einzelne Mitglieder bzw. ganze Mitgliedergruppen in zum Teil hochemotioneller Art und Weise diskreditierten. Denkwürdig war der Sonntagvormittag, als einige Leitungspersönlichkeiten ihre Empörung über das Abstimmungsergebnis zum Ausdruck brachten und den Mitgliedern regelrecht die Leviten gelesen haben.
Nein, der Würde des Goetheanums und der Gesellschaft entsprach vieles nicht, was durch die Leitung der Gesellschaft und der Hochschule zu verantworten war:
- Der Umgang mit der Zäsur von Bodo von Plato und Paul Mackay war im Grunde eine Verhöhnung der Mitgliedschaft, angesichts der 2011 zur Einführung der Zäsur vorgeschobenen Begründung, man wolle die Mitgliedschaft mehr einbeziehen und der nahezu vollständigen Nicht-Information (und damit Nicht-Einbeziehung) der Mitglieder in Bezug auf die Zäsur 2018. (Siehe „Ein neues soziales Feld entwickeln“ in dieser Ausgabe)
- Die regelrechte Treibjagt und Diskreditierung der Vorstandsmitglieder AGiS, die sich auf Nachfrage des Vorstands am Goetheanum die Freiheit erlaubt hatten, eine Amtszeitverlängerung nicht zu befürworten.
- Die Berichterstattung darüber in Anthroposophie weltweit, die in dem Beitrag von Jaap Sijmons gipfelte.[1]
- Durch die zeitliche enge Vorgabe des Vorstandes für die Behandlung von Mitgliederanträgen und -Anliegen 2018 und 2019 wird deutlich gemacht, dass man einen Einbezug der Mitgliedschaft nicht wünscht, es drückt sich darin eine regelrechte Missachtung der Mitgliedschaft aus, die 2019 insofern noch gesteigert ist, indem die Anträge und Anliegen nicht wie seit Jahrzehnten üblich im vollen Wortlaut in AWW veröffentlicht wurden und auch eine Übersetzung bisher nicht erfolgt ist (Stand 22. März 2019).
- Die Ignoranz der Leitung gegenüber den Argumenten und Gründen derjenigen, die einer Amtszeitverlängerung nicht zustimmen konnten.
- Die Verheimlichung der Tragweite der Aufgabendelegation an die Goetheanum-Leitung, die 2012 vereinbart wurde, der Mitgliedschaft jedoch erst 2018 durch den dritten Mitgliederbrief offenbart wurde.
- Die Veröffentlichung der Beiträge „Die offene Anthroposophie und ihre Gegner“[2] und die darin enthaltene vollkommen haltlose Diskreditierung von Mitgliedern – und Rudolf Steiner, verantwortet durch den Chefredakteur und den Sprecher des Goetheanum – damit verantwortet auch durch die Gesellschaftsleitung!
- Die unwahre Berichterstattung in den Publikationsorganen der Gesellschaft, die im Grunde durch ein sehr deutliches Votum der Mitgliedschaft an der Generalversammlung 2018 zu einem entsprechenden Antrag (Antrag 8) bestätigt wurde. Sowohl diese Tatsache als auch die in dem Antrag genannten Beispiele unwahrer Berichterstattung wurden durch das totale Schweigen der Leitung und der Redaktionen ebenfalls als zutreffend bestätigt.
- Im Zuge der Rechenschaft zu der Faustinszenierung 2016 wurde die Unfähigkeit der Leitung deutlich, bei der selber in Auftrag gegebenen Faustinszenierung im Gegensatz zu vielen Mitgliedern nicht rechtzeitig erkennen zu können, dass diese „spirituell nicht genügend durchdrungen“ (Bodo von Plato) war (Paul Mackay, warum es so lange gedauert habe: „Wir haben eben so lange gebraucht.“). Auch für die Neu-Inszenierung 2020 ist nicht zu erwarten, dass diese der Würde des Goetheanums angemessen sein wird. (Siehe ‹FAUST 2020› in „Ein Nachrichtenblatt“ Nr. 5, 10. März 2019).
- „Seit über 10 Jahren zeichnet sich ab, dass am Goetheanum die Spanne zwischen Ausgaben und Einnahmen zu gross wird“, so lautete die Feststellung des Vorstandes im Jahr 2010. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren in dramatischer Weise zugespitzt. Auch nach fast 20 Jahren kann vom Vorstand nicht erläutert werden, wie das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht werden soll.
- Weiter könnte der Umgang mit dem Zander-Zitat im Zusammenhang mit der Ausstellung „Rudolf Steiner Bilder“, die öffentliche und weltweite ungerechtfertigte Diskreditierung eines Mitgliedes durch J. Wittich in diesem Zusammenhang, der Umgang und die Haltung zur „Steiner Kritischen Ausgabe“ von Christian Clement und vieles andere mehr genannt werden.
Als wenn das alles nicht reichen würde – nun auch noch dieses:
Fotoshooting für Modewerbung im und am Goetheanum, im großen Saal, die Fenster im Hintergrund und, ganz gezielt, auch die Deckenmalerei. Ein Model in aufreizenden Pose, gekonnt inszeniert im oberen Saaleingang, das rote Fenster im Hintergrund (auch wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist) und auf weiteren Bildern Models in Eurythmie persiflierenden Stellungen Und als wenn das nicht schon genug wäre auch noch der Sektionsleiter, Mitglied der Hochschulleitung und Lektor sowie weitere Mitglieder des Goetheanum-Eurythmie Ensembles als Models in Designerklamotten und halbeurythmischen Posen!
Zu den Fotos
Aus der Erklärung von W. Held: „Das Goetheanum erhält beinahe wöchentlich Anfragen von Redaktionen und Agenturen, den Bau von außen und innen fotografieren oder filmen zu dürfen. In der Mehrzahl der Fälle – wenn es um Produktmarketing geht – lehnen wir solche Gesuche ab, um die Identität des Goetheanum zu schützen. … Die Tatsache, dass Lukas Wassmann, der Fotograf des im Magazin publizierten Beitrags, seiner verstorbenen Mutter, die, selbst Eurythmistin, an der Else-Klink-Eurythmieschule als Haushälterin tätig war, diese Fotoserie widmen wollte, ließ uns sein Vorhaben wohlwollend prüfen. In diesem Fall haben wir nach Rücksprache im Haus der Fotoserie zugestimmt. “
Hier stellen sich gleich mehrere Fragen: Der einzige positive Grund, der von Wolfgang Held genannt wird, ist die Tatsache, dass der Fotograf der Sohn einer verstorbenen Eurythmistin gewesen ist. Das allein soll ausgereicht haben, um ein Vorhaben für eine Produktwerbung, die als Reportage getarnt ist, zu genehmigen? Und mit wem hat er Rücksprache gehalten, wer ist mit „im Haus“ gemeint, den er gefragt hat und der letztlich für die Genehmigung den Ausschlag gegeben hat? Und wie sind die Mitglieder des Eurythmie Ensembles dazu gekommen, als Models mitzumachen? Haben sie von der Bühnenleitung oder der Sektionsleitung einen entsprechenden Auftrag erhalten? Von Justus Wittichs Stellungnahme wurde berichtet: “Justus Wittich sprach von einer Gratwanderung, den der arme Wolfgang Held beschreiten müsse, um solche an das Goetheanum gestellte Anfragen zu entscheiden. Er [J. Wittich] habe sich die Bilder angeschaut und den Text hierzu [der Reportage] gelesen, und er meine, die Bilder seien grossartig, man hätte so etwas auch mit anthroposophischen Bekleidungsideen längst machen sollen, und der Text sei von allerhöchster Qualität.”
Wenn in der Leitung des Goetheanum und der Gesellschaft schon kein Gespür mehr für die Würde des Hauses vorhanden ist (man vergegenwärtige sich, dass es sich bei den Leitenden um Mitglieder der Hochschulleitung handelt, die zumeist auch Lektoren sind, d. h. Klassenstunden halten) muss man doch fragen, ob denn niemand auf die Idee gekommen ist, dass diese vollkommen unnötige Aktion von sehr vielen Mitgliedern empört abgelehnt werden könnte? Zu meinen, man habe das nicht bedacht, wäre wohl eine Beleidigung der intellektuellen Fähigkeiten der Verantwortlichen.
Zur Würde des Goetheanums gehört auch, inwieweit wahr und ehrlich im Goetheanum gesprochen (und geschrieben) wird. Die Zäsur wurde 2011 eingeführt, weil „auch die Mitglieder verstärkt in die Verantwortung einbezogen werden“ [3] sollten und „Gern möchten wir die Zusammenarbeit der Mitglieder mit den Verantwortungsträgern verstärken, sodass die Gesellschaft zum Partner des Vorstands wird und sich nicht als Gegenüber versteht.“[4] Hatte die Entwicklung der letzten Jahre bereits gezeigt, dass davon keine Rede sein konnte, wird jetzt durch den Antrag von Paul Mackay zugegeben, dass es sich bei den damaligen Begründungen und Aussagen um Unwahrheiten – oder wohl doch: um bewusste Lügen – gehandelt hatte, eine schwere Verletzung der Würde des Goetheanum und der Gesellschaft und, so stellte sich jetzt heraus, ein schwerer Vertrauensbruch gegenüber der Mitgliedschaft, denn, wie schon angedeutet, wurde nichts von dem, was damals versprochen wurde, auch nur im Ansatz zu realisieren versucht. Im Gegenteil, wie die Zäsur 2018 gezeigt hat und wie sich jetzt für die Zäsur 2019 ebenfalls abzeichnet. So ist die Begründung, die Paul Mackay vorbringt, ein regelrechter Paukenschlag: denn er gibt heute unumwunden zu, dass die damalige Einführung der Zäsur eine taktische Gegenreaktion auf den damaligen Abwahlantrag war. Nachdem er nun Opfer seiner eigenen Taktik geworden ist, möchte er dass die Amtszeitbegrenzung wieder aufgehoben wird. Dieses Vorgehen erscheint an unverfrorener Dreistigkeit kaum noch zu überbieten zu sei. Oder doch? Denn ist es vorstellbar, dass dieser Antrag von ihm nicht im Einvernehmen mit dem Vorstand, der Goetheanum-Leitung und/oder den Generalsekretären gestellt wurde? Auch dieses Vorgehen ist mit der Würde nicht nur des großen Saales sondern der Gesellschaft, der Anthroposophie und einer Verantwortung der Hochschule gegenüber vollkommen unvereinbar.
Die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstandes erfolgen an den Generalversammlungen in aller Regel mit grosser Mehrheit, auch wenn in den letzten Jahren die Enthaltungen (die wohl gezählt, aber nicht gewertet werden) durchaus zugenommen haben. Die Zustimmung und Entlastung entspricht einem Auftrag: „Bitte weiter so!“ Angesichts dieses Auftrags seitens der Mitglieder ist es dann aber auch nicht verwunderlich, wenn sich die hier beispielhaft angeführten Zu- und Missstände fortsetzen und steigern.
Thomas Heck, 22. März 2019
[1] Anthroposophie weltweit 7-8/18 und „Wann treten Sie zurück?“, Ein Nachrichtenblatt Nr. 18, 16. September 2018 bzw. www.gv-2019.com/letter-to-sijmons
[2] Anthroposophie weltweit 7-8/18
[3] Anthroposophie weltweit 3/11
[4] Anthroposophie weltweit 5/11
von Thomas Heck | Feb 19, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Erläuterungen zur Unterscheidung der Statuten der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, dem sogenannten Gründungs-Statut und den Statuten der Weihnachtstagungs-Gesellschaft folgen in Kürze.
Weitere z.T. in den Fussnoten erwähnte Beiträge und Materialien zu den Anträgen:
von Thomas Heck | Feb 6, 2019 | Allgemein, Anthroposophische Bewegung, Anthroposophische Gesellschaft
Für Rudolf Steiner bestand mit dem Beginn des öffentlichen Wirkens für die Anthroposophie und die Ermöglichung neuer christlicher Mysterien von Anfang an die Notwendigkeit, dafür einen geeigneten Gesellschaftszusammenhang zur Verfügung zu haben. Die alten, auf autoritativen Formen und strengen Regeln beruhenden Sozial-Zusammenhänge, in denen das Mysteriengeschehen stattfand, kamen für den zur Freiheit strebenden Menschen nicht mehr in Frage, sie waren nicht mehr zeitgemäss. „Wir haben kein Recht, Autorität zu erzwingen: Erste Gemeinschaft, die Organisation mit Freiheit anstrebt.“[1] so Rudolf Steiner im Jahr 1906 an der Generalversammlung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Nachdem ein Wirken im Rahmen dieser Gesellschaft nicht mehr möglich war, erfolgte die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft 1913 in Köln. Im Gegensatz zur Theosophischen Gesellschaft übernahm Rudolf Steiner in dieser Gesellschaft keine Leitungsaufgaben, worauf er nach der Weihnachtstagung hinwies:
„Als die Anthroposophische Gesellschaft 1913 begründet worden ist, hat es sich darum gehandelt, einmal wirklich aus einem okkulten Grundimpuls heraus die Frage zu stellen: Wird diese Anthroposophische Gesellschaft sich weiter entwickeln durch die Kraft, die sie bis dahin in ihren Mitgliedern gewonnen hatte? Und das konnte nur dadurch auserprobt werden, dass ich selber, der ich ja bis dahin als Generalsekretär die Leitung der Deutschen Sektion hatte, als welche die anthroposophische Bewegung in der Theosophischen Gesellschaft drinnen war, dass ich selber dazumal nicht weiter die Leitung der Anthroposophischen Gesellschaft in die Hand nahm, sondern zusehen wollte, wie diese Anthroposophische Gesellschaft sich nun aus ihrer eigenen Kraft entwickelt.“[2]
Die Mitglieder konnten die Impulse nicht ergreifen und nach dem vergeblichen Bemühen um eine Konsolidierung der Gesellschaft im Jahr 1923, hatte Rudolf Steiner erwogen, sich ganz von der Anthroposophischen Gesellschaft zurückzuziehen.[3] Erst kurz vor der Weihnachtstagung fällt der endgültige Entschluss zur Neubegründung, „nach schwerem inneren Überwinden“[4], ein letzter Versuch, so schreibt Rudolf Steiner am 1. Dezember 1923 an Marie Steiner: „Denn ich setze für die Gesellschaft gewissermaßen letzte Hoffnungen auf die Weihnachtszusammenkunft.“[5] Es handelte sich um einen frei gefassten Entschluss von Rudolf Steiner, die Initiative zu der Neugründung zu ergreifen und auch mit der Aufgabe des 1. Vorsitzenden die Leitung der Gesellschaft wieder zu übernehmen. Er allein entwickelt die Statuten, bestimmt die Struktur und die Gestalt dieser Neugründung. Die Einsetzung des Vorstandes erfolgt einerseits durch ihn, er bezeichnet dies selbst als „etwas aristokratisch gehandhabte Einsetzung des Vorstandes.“[6] Die tatsächliche Einsetzung des Vorstandes und die Entstehung der Gesellschaft ist aber von der Zustimmung der Mitglieder abhängig. Die Initiative geht vollständig von Rudolf Steiner aus, die freie Tat eines Menschen einerseits, gleichzeitig ein esoterischer Vorgang und eine esoterische Handlung eines Eingeweihten andererseits, den Impulsen der geistigen Welt folgend, um wieder eine Verbindung zwischen der geistigen Welt und den Menschen zu ermöglichen. Ein eigentlich in sich widersprüchliches, von der Zeit gefordertes völlig neues Unterfangen: Eine Synthese aus der streng hierarchischen Ordnung der geistigen Welt und den Anforderungen einer durch die Mitglieder selbst bestimmten Organisation, die dem sich zur Freiheit entwickelnden Menschen Rechnung trägt. Diese Synthese kann nicht ausschliesslich auf einer bestehenden Rechtsordnung gründen, dazu ist ein freies Vertrauensverhältnis notwendig, dass das jeweilige Überhandnehmen des aristokratischen oder des demokratischen Prinzips ausschliesst. Rudolf Steiner am 25. Dezember 1923 während der Statutenbesprechung:
„Also ich meine, in der Praxis wird kein so großer Unterschied sein zwischen Demokratie und Aristokratie. Wir könnten ja in den nächsten Tagen einmal die Probe aufs Exempel machen und könnten fragen, ob der Vorstand, den ich vorgeschlagen habe, gewählt oder nicht gewählt wird. Dann hätten wir ja auch eine demokratische Voraussetzung; denn ich setze voraus, daß er gewählt wird, sonst würde ich doch auch wieder zurücktreten! Nicht wahr, es muß doch Freiheit herrschen. Aber, meine lieben Freunde, Freiheit muß auch ich haben. Ich kann mir nichts aufoktroyieren lassen. Freiheit muß doch vor allen Dingen auch derjenige haben, der die Funktion ausüben soll.“[7]
Die Freiheit Rudolf Steiners besteht darin, dass er zurücktreten würde, wenn ihm der von ihm vorgeschlagene Vorstand von den Mitgliedern nicht zur Seite gestellt oder das Vertrauensverhältnis auf andere Art und Weise beeinträchtigt worden wäre.
Die Statuten dieser Gesellschaft
„… sind auf das rein Menschliche eingestellt. Sie sind nicht eingestellt auf Prinzipien, sie sind nicht eingestellt auf Dogmen, sondern in diesen Statuten ist etwas gesagt, was rein an das Tatsächliche und Menschliche anknüpft, meine lieben Freunde.“[8]
Rudolf Steiner stellt seine Initiative frei vor die versammelten Mitglieder hin, er bezieht sie ein durch die intensive Beratung der Statuten und die Beantwortung von Fragen, er erläutert jede Formulierung bis ins Detail und begründet gegenüber den Mitgliedern jede Entscheidung in Bezug auf die Vorstandsmitglieder und die Sektionsleiter. Der gesamte langwierige Prozess ermöglichte den Mitgliedern jeden Schritt vollbewusst zu durchdringen und mittragen zu können.
Die Vorstandseinsetzung wird dann durch die Mitglieder bestätigt:
„Dann bitte ich Sie, jetzt nicht durch eine Abstimmung in dem Sinne wie die früheren Abstimmungen waren, sondern mit dem Gefühl: Sie geben diesem Grundcharakter der Führung einer wirklichen Anthroposophischen Gesellschaft recht, bitte ich Sie, Ihre Zustimmung dazu zu geben, dass dieser Vorstand hier für die Führung der Anthroposophischen Gesellschaft gebildet werde.“ [9]
Auch den Statuten als Ganzes stimmen die versammelten Mitglieder am 28. Dezember 1923 zu.
Die Mitglieder bilden so in freier Selbstbestimmung nach der Initiative Rudolf Steiners mit ihm diese neue Gesellschaftsform. Es vereinigt sich das aristokratisch-esoterische Prinzip der Initiative „von oben nach unten“ aus der geistigen Welt heraus mit dem irdisch-demokratischen Prinzip, hier der Bestätigung der geschaffenen Wirklichkeit durch die Zustimmung „von unten nach oben“. So entsteht die modernste Gesellschaft, die es geben kann – „denn die modernste Gesellschaft soll eben die Anthroposophische Gesellschaft sein, die hier begründet wird“[10]
Bestand wird dieses Gebilde nur dann haben können, wenn es aus dem Bewusstsein dieser besonderen Gestalt jenseits rechtlicher Ansprüche das „Leben“ aus dem gegenseitigen Vertrauen gestalten kann.
„Man sollte sich zum Bewusstsein bringen, dass damit die Anthroposophische Gesellschaft eigentlich einen esoterischen Charakter bekommen hat; nicht mehr eigentlich eine Vereinigung wie andere ist, sondern etwas ist, was selber Anthroposophie wirken will. Das wird sie nur können, wenn dieses wirklich überall verstanden wird. Denn Anthroposophie kann wirklich nur in voller Freiheit wirken, wenn dieses Wirken überall immer auf Verständnis auftrifft. Anthroposophisches Wirken kann kein Wirken von oben herein sein, obwohl es ein Wirken sein muss, das von Initiative abhängig ist. Deshalb haben wir bei der Dornacher Tagung so stark betont, dass der dort gebildete Vorstand ein Initiativvorstand, und nicht ein Verwaltungsvorstand sein will. Man wird deshalb auf dasjenige sehen müssen, was er tut, weil ihm etwas einfällt, weil er Gedanken und Ideen hat zum Wirken, weil er ein Initiativvorstand ist. Und als solchen wird man ihn anzusehen haben als eine Art wirklichen esoterischen Mittelpunkt der anthroposophischen Bewegung. In viel höherem Grade als das bisher der Fall war, wird man anthroposophische Bewegung und Anthroposophische Gesellschaft zu identifizieren haben. Sie werden eins sein. Nur unter diesen Bedingungen konnte ich mich selber entschließen, den Vorsitz zu übernehmen und diese Gesellschaft bei der Dornacher Weihnachtstagung zu ersuchen, denjenigen Vorstand mir an die Seite zu stellen, mit dem ich glauben kann, dass ich meine Intentionen durchführen kann.“ [11]
Die eigentliche Gesellschaftsbildung entsteht in der Mitte, es ist ein lebendiger Prozess, im vertrauensvollen Zusammenwirken dadurch, dass die geistigen Impulse von den Mitgliedern ergriffen werden und sich diese um die Verbindung zur geistigen Welt bemühen. Es entstand so in diesem Zusammenwirken der Initiative Rudolf Steiners als Repräsentant der geistigen anthroposophischen Bewegung mit den sich frei in diese Gesellschaft stellenden Mitgliedern eine Art dreigliedriges Wesen. Dessen Mitte konnte als atmendes pulsierendes Leben nur in vertrauensvoller Zusammenarbeit entstehen, indem die Mitglieder die Intentionen Rudolf Steiners in Freiheit bejahen und verwirklichen und damit gleichzeitig durch ihre Arbeit aus dem Umkreis die individuellen Bausteine für das „geistige Goetheanum“ bringen.
So war die modernste Gesellschaft entstanden, die es geben kann. Was aus daraus geworden ist, soll im nächsten Jahr angeschaut werden.
Thomas Heck
[1] Zitiert nach Hella Wiesberger, GA 259, 1991, S. 843
[2] GA 260a, 1987, S. 204, Hervorhebung Thomas Heck
[3] U.a. in Dr. F. W. Zeylmans van Emmichoven: Entwicklung und Geisteskampf 1923-1935, Den Haag, 1935 oder GA 232, 1998, S. 234.
[4] GA 260, 1994, S. 39
[5] GA 262, 2002, S. 361
[6] GA 260, 1994, S. 82
[7] GA 260, 1994, Seite 82f
[8] GA 260, 1994. Seite 41
[9] GA 260,1994, Seite 162
[10] GA 260,1994, Seite 125
[11] GA 260a, 1991, S. 182f